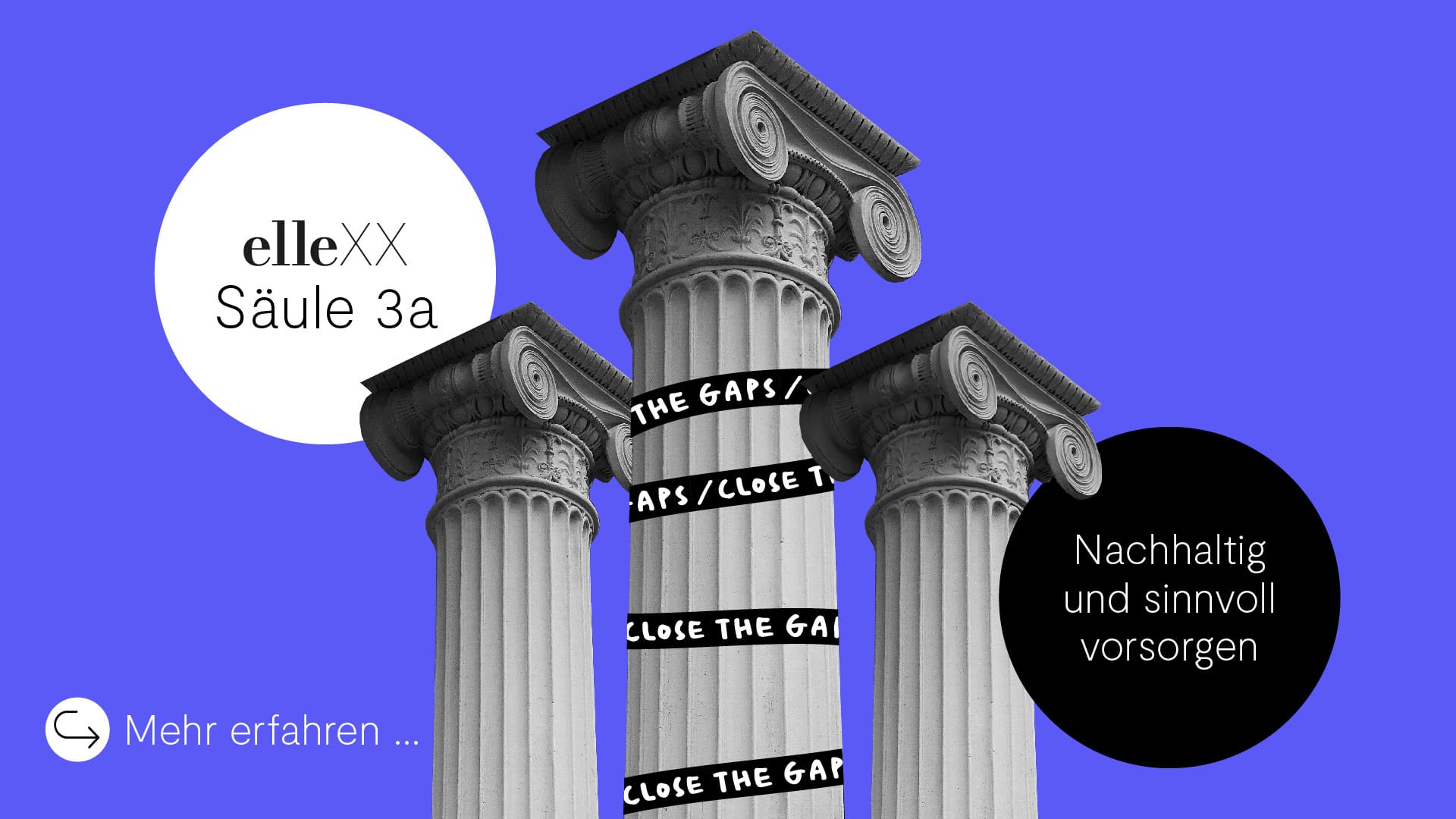Mütter gehören in den Augen vieler Schweizer:innen zwar nicht mehr den ganzen Tag an den Herd, aber die Erwartungen an sie seitens Gesellschaft und Politik haben sich seit Jahrzehnten – trotz feministischer Bewegungen – kaum verändert: Mütter, die in Vollzeit einer Lohnarbeit nachgehen, sind demnach Rabenmütter. Mütter, die sich entscheiden, für den Haushalt zu sorgen, gelten aber wiederum als konservativ.
Leben sie nach einer Scheidung nicht im gleichen Haushalt wie die Kinder, werden sie – im Gegensatz zu geschiedenen Vätern – massiv angegriffen. Mütter sind, so die noch immer verbreitete Annahme, für die Care-Arbeit, für die emotionale Arbeit, für die Liebe in der Familie zuständig. Mütter, die sich trotz der Kinder selbst lieben, Zeit für sich beanspruchen, sich weiterentwickeln und auch ausserhalb der Familie orientieren möchten, gelten schnell als «nicht normal», als «in der Krise» oder «selbstsüchtig».
Die Forscherinnen Lisa Yashodhara Haller und Alicia Schlender ergründen in ihrem Handbuch «Feministische Perspektiven auf Elternschaft» unter anderem solche Zuschreibungen und Reaktionen. Sie sprechen beim vorherrschenden Mutterbild in unseren Breitengraden vom «Narrativ der leistungsbereiten, attraktiven und sich selbst verwirklichenden Top Mom». Sie untersuchen, wie der Neoliberalismus Frauen nicht aus der Care-Arbeit gebracht, sondern ihnen eine zusätzliche Aufgabe gegeben hat, die sie zu erfüllen haben: Du musst unter allen Umständen ökonomisch unabhängig sein und dazu dennoch die Care-Arbeit übernehmen.
Der Druck der Gesellschaft, eine solche leistungsbereite und -fähige, angepasste, aufopfernde und liebevolle Mutter zu sein, ist noch stärker spürbar, wenn das Kind eine Behinderung hat. Doch kaum ein Buch oder eine Studie widmet sich Müttern von Kindern mit Behinderungen, so wie ich eine bin.
Meine Tochter ist knapp neun Jahre alt und hat eine starke Entwicklungsstörung, eine kognitive Behinderung mit autistischen Zügen und eine Sprachbehinderung. Mein Sohn hat ein ADHS, also eine psychische Erkrankung. Beide werden teilweise durch die IV unterstützt und haben sonderpädagogischen Bedarf. Grosse Teile der Gesellschaft erwarten von mir, dass ich mich in der Rolle der pflegenden Mutter ohne jegliche Widersprüche und Fragen wiederfinde, mich für meine Kinder quasi auflöse, die absolute «Übermutter» bin.
«Du willst halt so viel»
«Frauen an den Herd? Auf mich bezogen wäre die Forderung wohl: Mütter behinderter Kinder an das Pflegebett!», schreibt Journalistin Mareice Kaiser in ihrem klärenden und wichtigen Buch «Alles inklusive». Sie ist damit eine der wenigen Feministinnen, die das Thema Inklusion und Behinderung behandelt. Wir Mütter von Kindern mit Behinderungen sollen uns also während 24 Stunden, an sieben Tagen die Woche, ohne Ferien und Feiertage der Pflege, der Förderung und der besonderen Bedürfnisse unserer Kinder annehmen.
Weil: aus Liebe und Sorge, aus Verpflichtung, da das Kind ohne uns hilflos wäre. Als ob ein Kind mit Behinderung aufzuziehen bedeutet, keine eigenen Bedürfnisse, keine eigene Identität als Frau, als Mensch mehr zu haben, sondern nur noch Hingabe und damit Selbstaufgabe zu leben.
Dazu erwarten viele Menschen, dass ich dankbar bin: Für ein Leben in der Schweiz, weil es mit einem behinderten Kind in anderen Ländern noch schlimmer sei, weil wir eine kleine «Hilflosenentschädigung» von der IV bekommen. «Sei mal dankbar für das, was ihr bekommt, anstatt gegen die IV zu wettern», sagte mir kürzlich eine Verwandte. «Du willst halt so viel, kein Wunder, bist du müde. Ein Kind mit Behinderung ist ja schon eine ausfüllende Aufgabe für sich», analysierte eine andere Bekannte.
Die Vorstellung darüber, was eine gute Mutter eines behinderten Kindes ist, was sie überfordert und belastet, was sie zusätzlich zur Aufgabe der Betreuung noch leisten kann und darf, spüre ich täglich. Sei es mit solchen Aussagen oder zum Beispiel an früheren Arbeitsstellen, wo man mir immer wieder Bedauern aussprach über meine schwierige Situation. War ich erschöpft, war es meine Situation zu Hause und nicht die Überbelastung im Job. Oder auf dem Spielplatz, wo man mir immer wieder sagte: «Ich könnte das ja nicht bewältigen, was du machst.» Gemeint damit war jedes Mal: Einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachgehen, ein Kind mit Behinderung haben und meinen Bedürfnissen Raum geben.
Verantwortlich sind die Mütter – nicht die Väter
Seit meine Tochter Ronja* geboren wurde, war auch für einige Verwandte sofort klar, was meine Aufgabe als Mutter ist: Ich soll immer verständnisvoll, immer geduldig, für immer fürsorglich, immer verfügbar sein – und zwar nicht nur, bis die Kinder in die Schule kommen oder bis sie ausziehen, sondern bis ich sterbe. Denn mein Kind mit Behinderung, so die Annahme, ist auch als Erwachsene auf Bemutterung angewiesen – «Bevaterung» hingegen braucht es nicht. Und nicht der Staat, Gemeinschaften, eine Gesellschaft oder eine gesamte Verwandtschaft sorgen dafür, dass Menschen wie Ronja mit ihrer Behinderung selbstbestimmt in ihrem Haus, in einer betreuten Wohngemeinschaft oder in einer Wohnung mit Assistenz leben können.
Dass diese Bemutterung bis ins Erwachsenenalter unter Umständen gar nicht förderlich ist für die Selbständigkeit und gesunde Ablösung von erwachsenen Kindern von ihren Müttern, wird dabei genauso ignoriert wie die Tatsache, dass Mütter auch Menschen sind. Und keine unbezahlten Pflegeroboter bis ins Alter, mit denen der Staat Milliarden von Stunden Assistenzarbeit einspart.
Was wir Mütter von Kindern mit Behinderungen brauchen? Das gleiche wie Mütter von nichtbehinderten Kindern. Eine gleichberechtigte Partnerschaft, weniger Erwerbsarbeitszeit, bezahlbare und qualitativ hochstehende Kinderbetreuung, damit die Vereinbarung von Kind und Job gelingt. Eine faire Aufteilung und Wertschätzung der Care-Arbeit. Und dazu ein System, in dem Menschen mit Behinderungen und ihre Eltern nicht unter Generalverdacht stehen, Gelder und Leistungen der IV zu erschleichen. Ein System, in dem wir die Hilfeleistungen bekommen, die wir als Familie brauchen, um alle gesund zu bleiben.
Und eine Gesellschaft, die unsere Kinder willkommen heisst, sie als genauso wertvolle Mitglieder wie Menschen ohne Behinderungen sieht. Sie in ihrer Selbstbestimmtheit zum Beispiel beim Wohnen und in der Schule unterstützt, ihnen keine Hindernisse in den Weg stellt und ihnen alle Rechte und Möglichkeiten zuspricht – so wie es in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Mutterschaft und Behinderungen? Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft? Schreiben Sie es mir.
*Die Tochter der Autorin heisst mit richtigem Namen anders


.jpg-.jpg)