Unbewusste Vorurteile – neudeutsch: «unconscious biases» – sind ein grosses Hindernis auf dem Weg zu einer Gesellschaft ohne Diskriminierung. Entsprechend boomen Trainings, in denen Teilnehmer:innen lernen sollen, ihr Verhalten zu reflektieren und Menschen vorurteilsfreier und damit objektiver zu begegnen.
Ich hatte kürzlich ein solches Training. Allerdings unfreiwillig. Anlass war ein ungeplanter Spitalaufenthalt. Meine «Trainerin» war meine Zimmernachbarin. Nennen wir sie Frau Hutter.
Frau Hutter ist eine Frau Ende 50. Sie freute sich sichtlich über meine Ankunft. Sie hatte nämlich Redebedarf. Schliesslich hatte sie vor wenigen Tagen temporär die Sprache verloren. Und das hatte ihr einen gehörigen Schrecken eingejagt. Ihrem Partner, der später vorbeikam, auch. Oder wie er es ausdrückte: «Also, wenn die Alte da mal nicht mehr redet, dann weisst du, dass wirklich etwas nicht stimmt.»
Zum Zeitpunkt meiner Einlieferung war Frau Hutter schon ein paar Tage im Spital und stand kurz vor dem Austritt. Ihre Erleichterung über ihre schnelle Genesung war spürbar. Kaum wurde ich in meinem Bett ins Zimmer gerollt, schmetterte sie mir ein herzliches «Grüezi! Ich bin Frau Hutter. Wer sind Sie?» entgegen. Ich grüsste höflich zurück und stellte mich ebenfalls mit meinem Namen vor.
Die Reaktion erfolgte postwendend: «Läck, endlich jemand, der Schweizerdeutsch redet …», gefolgt von Klagen darüber, dass sie die letzten Tage nur fremdsprachige Zimmernachbarinnen hatte, die den ganzen Tag in Sprachen telefonierten, die sie nicht verstand. Und auch von den Angestellten würden viel zu wenig Menschen Schweizerdeutsch reden.
Ich zuckte zusammen und überlegte mir, ob das jetzt ein politisches Statement war. Neben wem war ich da bloss gelandet? Musste ich mir nun stundenlange fremdenfeindliche Monologe anhören? Wenn doch der Vorhang zwischen unseren Betten bloss schalldicht wäre … Widersprechen mochte ich angesichts meines Zustandes nicht, aber in meinem Kopf kristallisierte sich in Windeseile ein Stereotyp heraus. Aus einem Bruchteil an Information über Frau Hutter rechnete ich mir Horrorszenarien darüber aus, mit welchen unliebsamen politischen Meinungen ich sonst noch konfrontiert werden könnte in den nächsten 24 Stunden. Ich sah schwarz.
Nur, was sollte ich tun? Flüchten war keine Option. Ich war am Monitor angeschlossen. Bewegte ich mich zu stark, ging irgendein Alarm los. Ich atmete also tief durch. Und das war gut so. Denn von Frau Hutter lernte ich in den 24 Stunden, die wir nebeneinander lagen, mehr übers Leben, über Vorurteile und über soziale Gerechtigkeit, als in stundenlanger Lektüre von Feuilleton-Texten und Diskussionen mit meinen intellektuellen Freund:innen.
Frau Hutter arbeitet im Stundenlohn im Inventar bei einem Grossverteiler, auf Abruf. Sie hat ein sehr unregelmässiges Einkommen. So hatte sie wohl im Dezember gerade mal zwei oder drei Einsätze. In anderen Monaten sind es mehr. Daneben bezieht sie eine Teilrente der IV, denn jahrelange Arbeit im Service hat ihre Gelenke geschädigt. Dank den Prothesen in Knie und im Rücken bezeichnet sie ihren Körper inzwischen als «Ersatzteillager».
Gekündigt hat sie in der Gastronomie aber nicht etwa wegen den körperlichen Beschwerden, sondern weil sie es nicht mehr aushielt, wenn der Chef spät am Abend die Musik laut aufdrehte und sie von übergriffigen Betrunkenen umgeben war. Das erzählte sie ganz unaufgeregt und nebenbei.
Frau Hutter geht gerne in Deutschland einkaufen. Sie rechnete mir minutiös vor, wie viel sie bei den einzelnen Produkten, die sie dort kauft, spart und was das für sie für einen Unterschied macht. Nur Fleisch kauft sie nie in Deutschland. Sonst wird «der Chef daheim» wütend. Der «Chef daheim» ist ihr Lebenspartner. Und der ist Metzger in der Schweiz. Er arbeitet beim gleichen Detailhändler wie sie.
Frau Hutter macht sich Gedanken zu Nachhaltigkeit. Sie zweifelt am grünen Image ihres Arbeitgebers. Ihre Arbeitskolleg:innen, die mit dem Auto zum Inventar anreisen, bekämen nämlich eine viel höhere Spesenentschädigung als Leute wie sie, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Das seien doch vollkommen falsche Anreize, und das sei weder fair gegenüber den Menschen noch gut für die Umwelt! Von ihrem Partner weiss sie ausserdem, dass er angewiesen werde, die Fleischauslage im Laden immer üppig zu füllen – bis kurz vor Ladenschluss. Nur so würden die Leute zum Kaufen animiert. Das führe aber dazu, dass am Ende des Tages Food Waste entstehe. Und das sei doch auch überhaupt nicht nachhaltig.
Frau Hutter will Strom sparen. Ihr Partner hat deshalb Steckerleisten installiert. Trotzdem ist ihr Stromverbrauch doppelt so hoch wie derjenige ihrer Nachbarn. Wahrscheinlich sind es die alten Kühlgeräte. Aber man müsse halt auch berücksichtigen, dass ihr Partner und sie «aneinander vorbei arbeiten». 18 Stunden am Tag ist bei ihnen daheim jemand wach, und dann läuft meistens der Fernseher. Wenn die Strompreise steigen, wird das teuer.
Nächsten Monat wird Frau Hutter die Pensionskasse ausbezahlt. Aus welchem Grund, hat sie nicht erzählt. Aber darum ging es auch nicht. Mit dieser Auszahlung kommen fast 100'000 Franken auf einen Schlag auf ihr Konto. Der Gedanke daran überfordert sie. Aber sie muss auch lachen. Sie wird auf jeden Fall ein Erinnerungsfoto machen von diesem Kontostand. Soviel hatte sie noch nie drauf und wird sie auch nie wieder haben. Sie darf davon nur 10'000 Franken pro Jahr ausgeben. Das wird anscheinend kontrolliert. Schliesslich soll es möglichst lange reichen.
Zum Glück gebe es unentgeltliche Beratung durch wohltätige Organisationen, sagt sie. Die würden ihr die ganzen Finanzsachen ganz genau und geduldig erklären. Frau Hutter hat sich nie für Geld interessiert. Es hat immer grad so gereicht. Und jetzt plötzlich muss sie sich damit rumschlagen. Sie gehört zum Beispiel ausgerechnet zu den Jahrgängen, die durch die AHV-Reform, die wir letzten November knapp angenommen haben, benachteiligt werden. Da musste sie sich informieren. Inzwischen rechnet sie mir selbstverständlich vor, wann sie was bekommt und wieviel sie davon ausgeben darf.
Ich könnte noch mehr erzählen. Mein Punkt ist: Bei fast jedem Thema, das Frau Hutter ansprach, zuckte ich innerlich zusammen und meinte zu wissen, was jetzt kommen würde. Und tatsächlich sagte Frau Hutter einige Dinge, die so gar nicht in mein selbstdeklariert progressives Weltbild passten, aber gleichzeitig überraschte sie mich immer wieder. Sei es, indem sie sich anders positionierte als ich erwartet hätte. Oder weil sie ungefragt wirklich gute Gründe für ihre Meinung hatte. Und sie konfrontierte mich dabei derart effektiv mit meinen Vorurteilen, dass ich von ihr wahrscheinlich mehr gelernt habe, als es in einem didaktisch sorgfältig aufgebauten «unconscious bias training» der Fall gewesen wäre.
Ich bin nicht in Kontakt geblieben mit Frau Hutter. 24 Stunden nachdem sie sich mit einem fröhlichen «Adieu Frau Baur, ich bin nun wieder frei!» von mir verabschiedet hatte, wurde auch ich entlassen. Gesundheitlich einigermassen wiederhergestellt, aber vor allem berührt und dankbar. Für unser hervorragendes Gesundheitssystem und die grossartige Arbeit aller Menschen im Spital, aber vor allem auch für die Begegnung mit Frau Hutter.

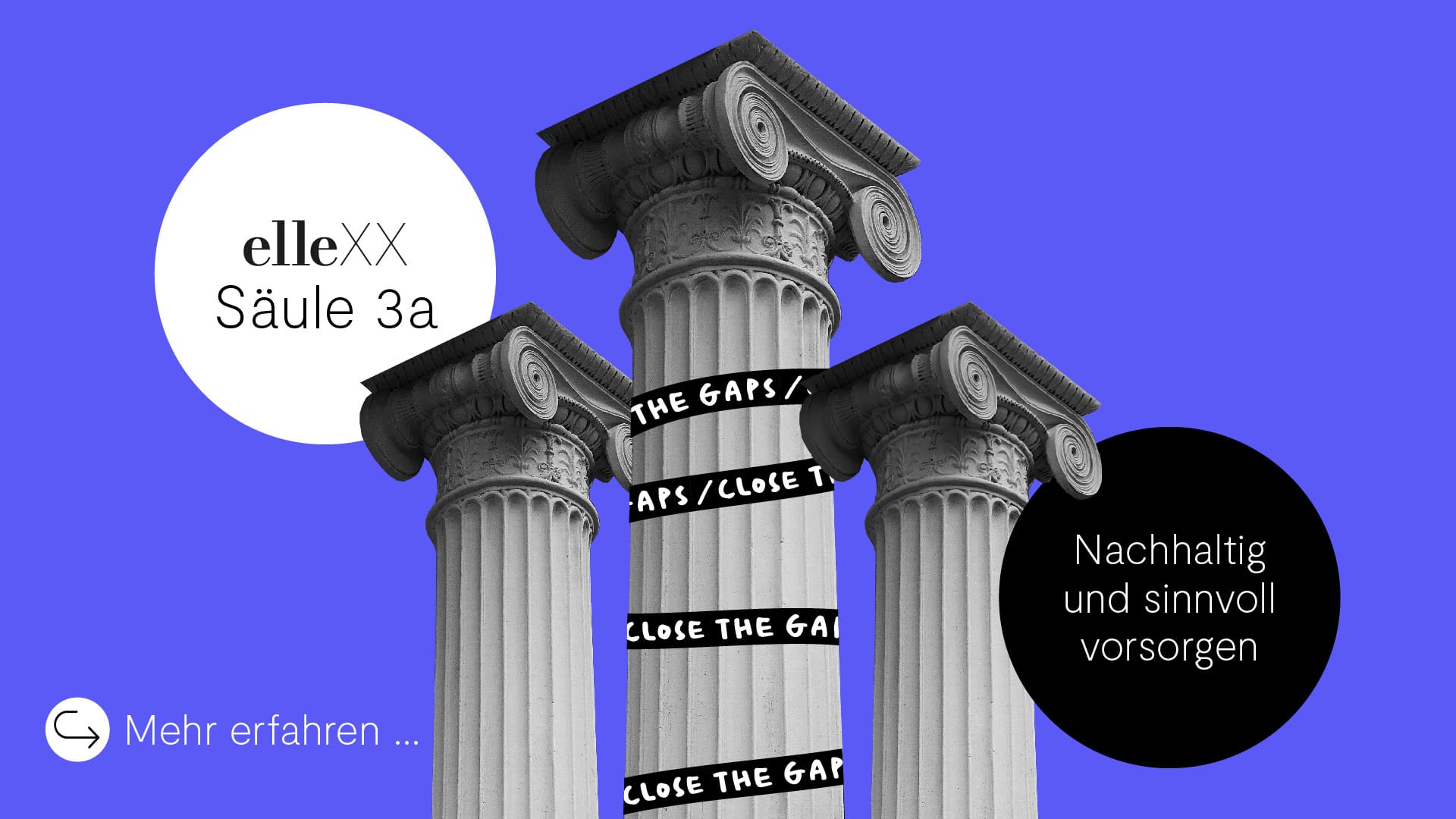
.jpg-.jpg)
