«Wie geht ein Leben mit einem Kind mit Behinderung?», wurde ich kürzlich im Podcast «Go Hug Yourself» von der Journalistin Ellen Girod gefragt. Meine Antwort war: «Ich weiss es nicht, ich mache einfach.» Sehr oft fehlen mir die Referenzen für das, was ich mit meinem Kind erlebe, und ich verlasse mich vor allem auf mein Gefühl. Das geht fast allen Eltern so; Eltern von Kindern mit Behinderungen oder psychischen und chronischen Krankheiten erleben diese Unsicherheit jedoch in extremis.
Erziehungsratgeber, Elternkurse, Elternblogs, Schulen, Informationsveranstaltungen zur Entwicklung eines Kindes, zur Pubertät oder Aufklärung – fast alle diese Angebote sind auf die sogenannte Norm ausgerichtet. Auch der Rat der Grosseltern fällt oft weg, die meisten von ihnen haben ja selbst kein Kind mit Behinderung grossgezogen. Und sogar Informationen von Kinderärzt:innen über das Leben mit einem Kind, das zum Beispiel wie meine Tochter Ronja eine neurologische Entwicklungsstörung hat, gibt es kaum. Meist erhalten Eltern nach der Diagnose die Broschüre einer Beratungsstelle und ein paar Kurzinformationen, mehr nicht. Die gesamte Unterstützung, das ganze Wissen über die Behinderung, alle Administration und alle Behördengänge müssen sie, solange die Familie «funktionsfähig» ist und nicht die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) eingeschaltet wird, selbst organisieren.
Menschen mit Behinderungen sind die grösste minorisierte Gruppe der Schweiz: 1.7 Millionen Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit leben hier – sie werden im Alltag jedoch fast überall vergessen und ausgegrenzt. So fehlt es noch immer an inklusiven Arbeitsplätzen, an Stimmen von Menschen mit Behinderungen in den Medien, an barrierefreien kulturellen Anlässen, an hindernisfreien öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden oder an gemeinsamen Sportvereinen zusammen mit Menschen ohne Behinderungen. Spürbar wird die Ignoranz oft schon ab dem ersten Lebenstag, dem Tag der Diagnose, dem Tag des Unfalls, dem Beginn der Krankheit: Das Kind mit Behinderung wird nicht mehr an das Geburtstagsfest der Nachbarskinder eingeladen, weil es zu aufwendig erscheint. In der Schule müssen die integrative Förderung, die Assistenz und die angepassten Räumlichkeiten eingefordert werden, weil sie sonst vergessen werden. Bei der IV herrscht der Grundsatzverdacht, die benötigten Massnahmen würden erschlichen, und in der Verwandtschaft wird entweder bemitleidet oder relativiert. So hörte ich mehrmals, wie traurig das doch sei mit Ronja, und im nächsten Satz, dass jedes Kind ja auf seine Art «speziell» sei und besondere Bedürfnisse habe.
Internalisierte Behindertenfeindlichkeit
Angesichts dieser Verhältnisse ist klar, dass es irgendwann nur noch wenige Berührungspunkte mit Menschen ohne Behinderungen gibt. Auch deshalb hatte ich vor Ronjas Geburt keine Ahnung vom Leben mit Menschen mit Behinderungen. Ich besuchte keine integrative Schule oder Vereine, weil es diese damals noch gar nicht gab, und erhielt keine Aufklärung über das gesamte Spektrum des Menschen. Die Ausnahme bildete ein Praktikum, das ich im Alter von 17 Jahren in einer Institution für Menschen mit Behinderungen absolvierte. Dort spürte ich aber vor allem Angst, Unsicherheit und Überforderung. Angst vor den Lauten der Menschen – viele hatten wenig Lautsprache – oder vor ihren vielen Fragen, ihrer Bedürftigkeit. Überforderungen durch die Körperlichkeit und Nähe, die sie brauchten, und Unsicherheit in Bezug auf die Pflege erwachsener Menschen.
Erst heute erkenne ich meine damalige internalisierte Behindertenfeindlichkeit: Aus Ignoranz und Unwissen sah ich die Menschen in diesem Heim nicht als Individuen, sondern als eine eigene Spezies Mensch, die versorgt und behütet werden muss, die keine eigenen Entscheidungen treffen können und froh sind, unter sich zu leben. So wurde es mir gesellschaftlich und auch in eben diesem Heim suggeriert; ich hatte damals keine Gründe, es zu hinterfragen.
Erst durch Ronja habe ich angefangen, meine Vorurteile und Berührungsängste abzubauen, mich mit meinen Privilegien, mit hindernisfreien Zugängen zu Bildung oder zum Arbeitsmarkt, mit alternativen Wohnformen wie Wohngemeinschaften für Menschen mit und ohne Behinderungen zu beschäftigen. Und ich gebe zu: Es fällt mir auch heute, nach knapp neun Jahren, manchmal schwer, Ronja ganz einfach als ein Kind anzusehen, das Selbstbestimmung will und ein Leben führen möchte, wie es die anderen Kinder ohne Behinderung in unserer Siedlung tun können.
Als weisse, nicht behinderte cis-Frau im Mittelstand erfahre ich zwar Sexismus, aber ich weiss nicht, wie es ist, eine Behinderung zu haben. Durch Ronja erfahre ich von einer Perspektive, die es mich erahnen lässt, wie diskriminierend unser System für Menschen ist, die nicht «der gesellschaftlichen Norm» entsprechen. Was für Kämpfe sie mit der IV und anderen Behörden, mit den Schulen, den Ausbildungsplätzen, Arbeitgebenden, Institutionen, mit den Therapeut:innen oder Ärzt:innen, Angehörigen und der gesamten Gesellschaft austragen müssen. Und dies, obwohl ihr Alltag bereits erschwert ist. Ein konkretes Beispiel ist die finanzielle Situation der Betroffenen: Menschen mit Behinderungen sind viel stärker armutsgefährdet als Menschen ohne Behinderungen, das besagt auch das Bundesamt für Statistik. Schon nur dieses Beispiel zeigt: Wir haben kein inklusives System in der Schweiz.
Menschen mit Behinderungen werden zu Hilflosen gemacht
Letztes Jahr rügte sogar die UNO die Schweiz, sie verletze die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Sie würden rechtlich zu wenig vor Diskriminierung geschützt, es gebe kaum fair bezahlte und angepasste Arbeitsplätze und es fehle an einer politischen Strategie für ein inklusives Schulsystem, so der Bericht. Passiert ist seither wenig. Oder wie der Behindertenaktivist, SP-Gemeinderat und Nationalratskandidat Islam Alijaj kürzlich an einem Panel im «Debattierhaus Karl der Grosse» sagte: «Die Schweiz hat genügend Geld, Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft unsichtbar zu machen und sie in Heimen zu versorgen.» Menschen mit Behinderungen werden also zu Hilflosen gemacht und damit von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. In einem Interview mit dem Amnesty-Magazin erklärt der Gemeinderat weiter: «Die Gesellschaft weiss noch sehr wenig über uns Menschen mit Behinderungen, über unseren Alltag und unsere Möglichkeiten. Wir gelten bei vielen noch immer als arme, hilflose Geschöpfe, die ‹versorgt› werden müssen.»
Meine Tochter hat mich politisiert. Durch meine individuellen Erfahrungen mit Ronja hat sich meine Perspektive verändert, bin ich auf die vielen strukturellen Hindernisse gestossen, die Menschen mit Behinderungen und ihren Familien begegnen, und auf meine eigenen verinnerlichten Vorurteile. Damit Inklusion jedoch möglich ist, muss dieser Prozess noch bei viel mehr Menschen passieren – auch bei Menschen, die keine Angehörigen mit Behinderungen haben. Sind Sie bereit, sich damit auseinanderzusetzen? Wichtig wäre es, nicht zuletzt deshalb, weil wir alle morgen einen Unfall haben könnten oder eine chronische Krankheit bekommen und uns spätestens dann ein inklusives System wünschen.



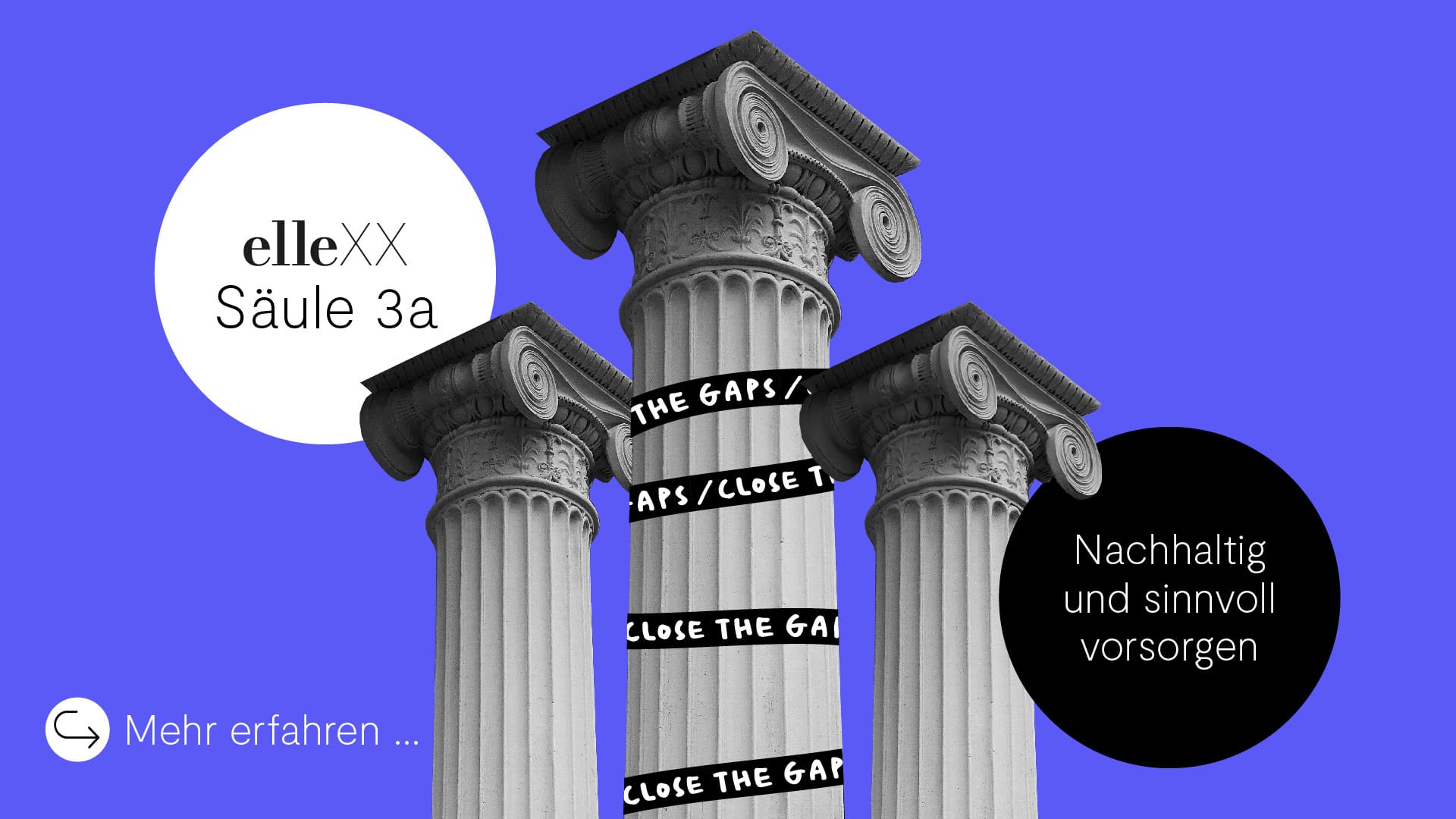
.jpg-.jpg)

