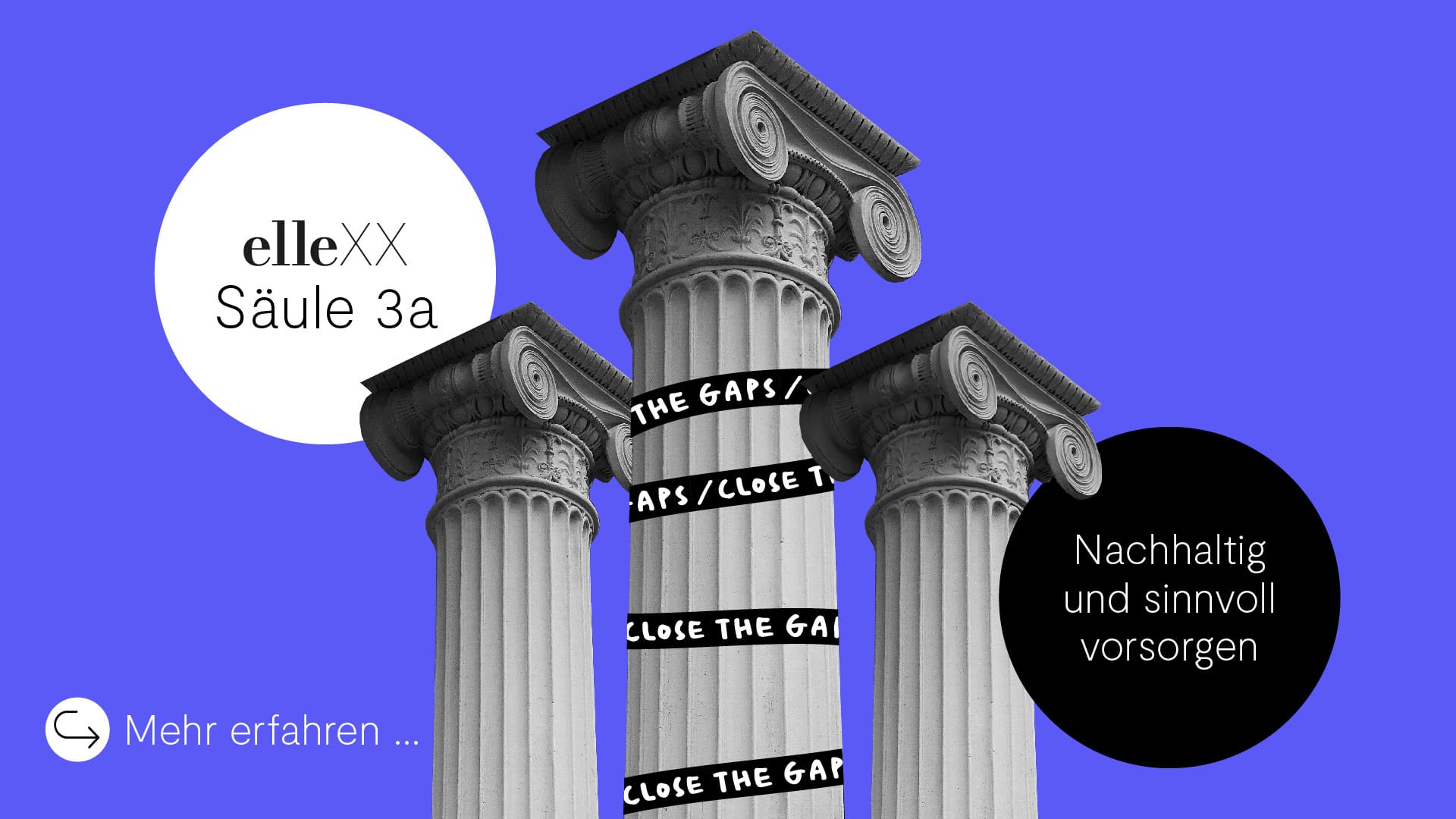Bald läuft die letzte Folge der SRF-Sendung «Deville», die Show wird nicht weitergeführt. Vor zwei Wochen hiess es seitens Schweizer Radio und Fernsehen, man sei auf der Suche nach einem Nachfolger für den Host und Komiker Dominic Deville: Zur Diskussion stehen die Komiker und Satiriker Stefan Büsser, «Deville»-Sidekick und Mitautor Patrick «Karpi» Karpiczenko und Gabriel Vetter, der bereits in seiner eigenen SRF-Radiosendung «Vetters Töne» zu hören ist.
Diese Entscheidung löste verständlicherweise viel Kritik aus: Dass offenbar keine einzige Frau als Nachfolgerin infrage kommt, veranlasste Frauen aus der Comedy-Szene zu einem offenen Brief. Unterzeichnerinnen sind unter anderem Patti Basler und Lara Stoll. In ihrem Schreiben berichten die Frauen von struktureller Benachteiligung beim SRF: Offenbar sei die Zusammenarbeit seit jeher unbefriedigend, Ideen von Comediennes werden teilweise geklaut und ohne Absprache umgesetzt: «Man lässt Leute arbeiten, Ideen und Konzepte entwickeln, versucht dann, Löhne zu dumpen, bis es im besten Falle ganz gratis ist.» Und wenn eine Frau eine Sendung plane, sei sie schliesslich immer noch der Deutungshoheit von Männern ausgesetzt.
Laura Köppen, Abteilungsleiterin Audience von SRF, rechtfertigt diese Auswahl gegenüber dem Branchenportal persoenlich.com so: «Der Sonntagabend ist das Schaufenster für unser Comedy-Programm. Es ist unser Ziel, auf diesem Sendeplatz möglichst viele Menschen anzusprechen.» Dementsprechend sei die Bekanntheit der Persönlichkeiten ein relevantes Auswahlkriterium. Zu keinem Zeitpunkt im Prozess habe es aber Vorgaben zum Geschlecht möglicher Hosts gegeben: «Vielmehr haben wir in den Studien beim potenziellen Publikum nachgefragt, welche Comediennes und Comedians sie sich am besten als Host am Sonntagabend vorstellen können. Dieser Umstand hat nichts mit der hohen Qualität und Anzahl an Comedyfrauen in der Schweiz zu tun. Aber diese Resultate spielten bei der Entwicklung eine entscheidende Rolle.» Die Männer lagen in dieser Umfrage weit vorne.
Dass bei der Auswahl für ein wichtiges Format nur Männer berücksichtigt werden, sei sicherlich auch nicht die Wunschvorstellung von SRF. Das Ziel bleibe, die Vielfalt der Comedy-Szene auch am Sonntagabend sichtbar zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, werde SRF künftig darauf achten, Diversität in ihrem Comedy-Angebot zu fördern, und sich bemühen, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis von 50:50 zu erreichen. Das ist auch angebracht, denn SRF hat sich im Rahmen seiner Strategie zur Geschlechtergleichstellung öffentlich zu diesen Bemühungen verpflichtet.
Man bemüht sich also offenbar – zumindest theoretisch –, diverser zu werden beim SRF-Comedyprogramm. Das wäre nicht zuletzt auch ein Abbild der Realität: Laut der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung von 2020 betrug der Anteil der Frauen in der Kategorie «Darstellende Kunst und Unterhaltung» 45,4 Prozent.
In der Schweiz prägen jedoch seit jeher Männer das Comedy-Programm. Und sie werden deshalb auch eher als Nachfolger engagiert. Der Kater beisst sich sozusagen in den Schwanz. Klar, das Publikum und seine Bedürfnisse entscheiden bei SRF. Bloss: Wer Frauen keine Bühne gibt, trägt nichts dazu bei, diesen Kreislauf aufzubrechen, und sorgt nicht dafür, dass sich das Publikum überhaupt darüber Gedanken machen kann, welche Frau es gerne im Programm sehen möchte. Es steht ja keine zur Auswahl.
Somit sorgt SRF nicht dafür, dass Frauen genauso erfolgreich sein können wie ihre Kollegen, dass sie gleich hohe Gagen verhandeln können und Ende Monat gleich viel auf dem Konto haben. Man trägt mit solchen Entscheidungen nicht dazu bei, dass Frauen die Karriereleiter gleich schnell hochklettern können, wenn sie denn wollen. Und man trägt damit auch nicht wirklich zur Gleichstellung bei.
Die Unterhaltungsabteilung von SRF prägt also ungerechte Strukturen mit. Sich als Künstlerin dagegen zu wehren braucht aber Mut: SRF hält ein Monopol als Arbeitgeberin inne, wer sich Chancen verbaut, kriegt vielleicht nie mehr einen Job beim Sender. Und die Comedyszene in der Schweiz ist klein, die Konkurrenz und daraus entstehende Abhängigkeit gross.
Was im Fernsehen stattfindet, prägt unsere Wahrnehmung der Realität. Dass in der Sendung «Deville» Frauen nur als Gäste oder als lustiger Sidekick (Musikerin Irene Brügger als «Frölein Da Capo» oder Michelle Kalt als TV-Anwältin) vorkommen, ist bereits beschämend. Und es trägt zum gesellschaftlichen Stigma bei, dass Frauen nicht so lustig sind wie Männer.
Natürlich: Auch Männer können lustig sein. Es ist aber problematisch, wenn sie die Einzigen sind, die uns im Rahmen einer eigenen SRF-Sendung Witze erzählen und das gesellschaftliche Leben satirisch unter die Lupe nehmen. Der männliche Blick ist ein anderer als der weibliche. Und für echte Diversität braucht es beide. Warum also nicht zwei Hosts – eine Frau und ein Mann? Es bleibt zu wünschen, dass SRF das in naher Zukunft einsieht. Potenzielle Kandidatinnen für eine «Devilla» gäbe es jedenfalls mit Comediennes wie Patti Basler, Gülsha Adilji, Lara Stoll, Hazel Brugger, Lisa Christ, Fatima Moumouni oder Michelle Kalt mehr als genug.