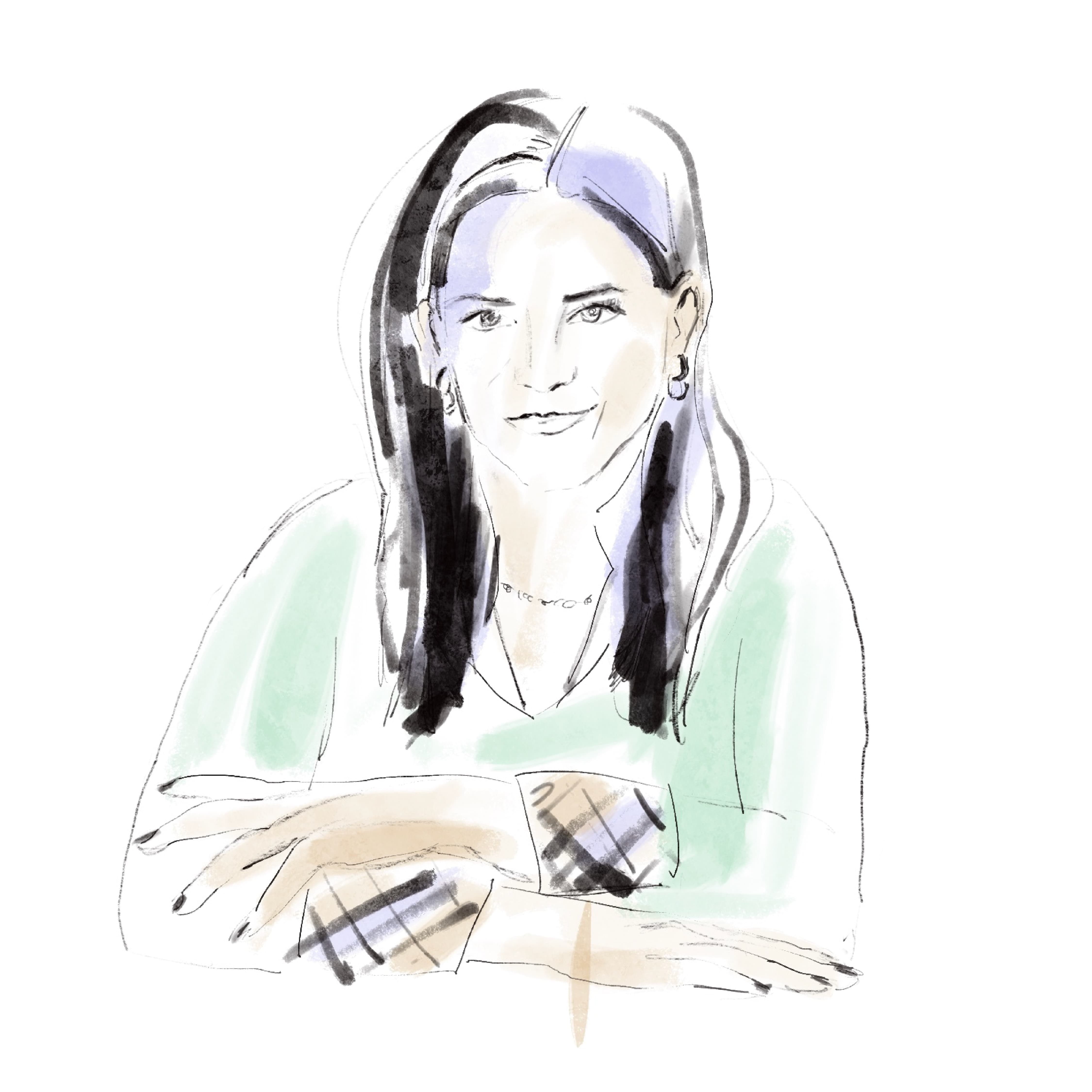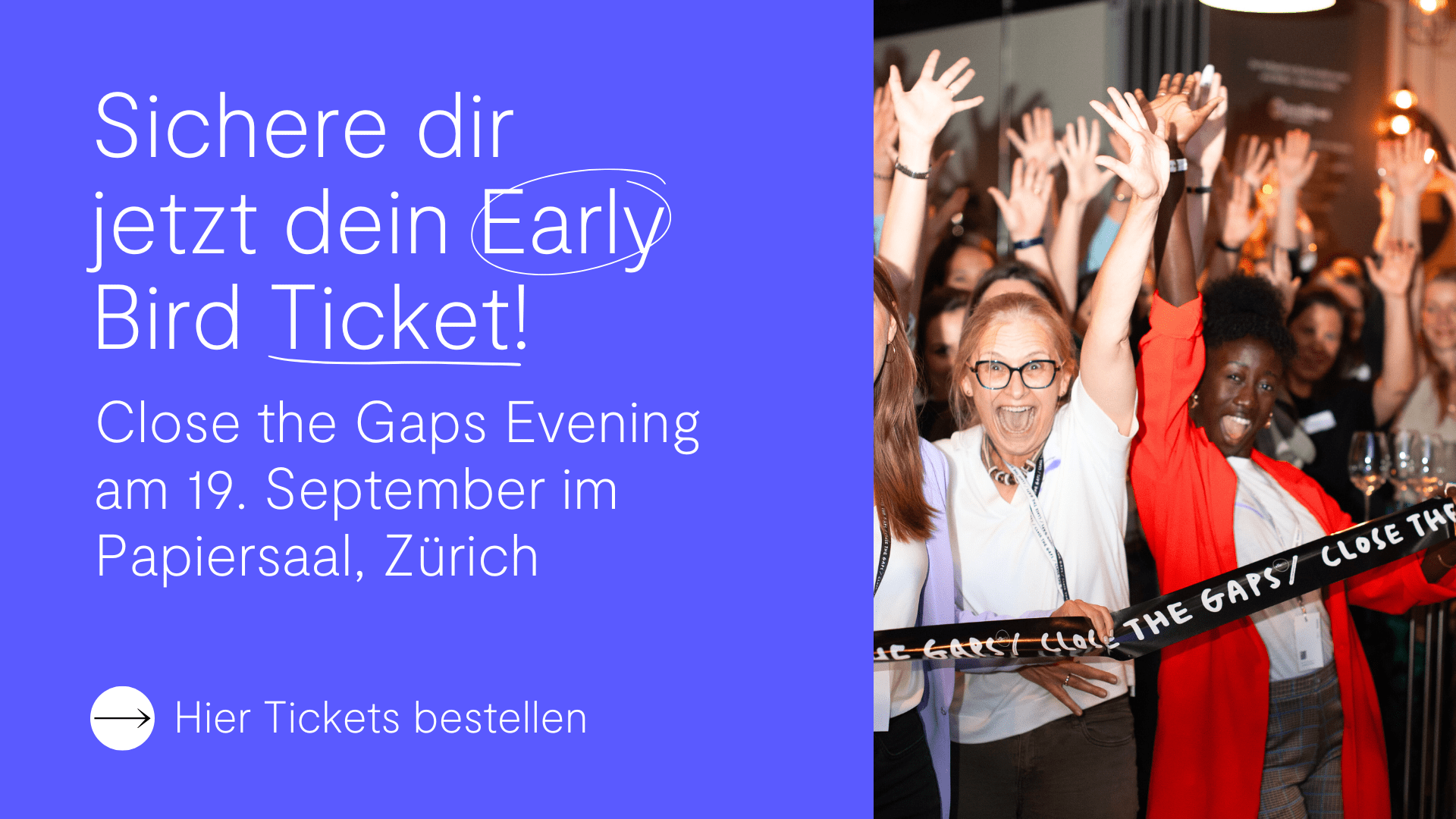Mit 16 Jahren wurde ich zur Co-Präsidentin eines der grössten Jugendparlamente in der Schweiz gewählt. Die Wahl war knapp, mit einer Stimme Unterschied zum Gegenkandidaten. Nach der Wahl kam ein Mitglied auf mich zu und sagte, dass es mir seine Stimme nur gegeben hätte, weil ich eine Frau bin. Ich war also eine Quotenfrau.
Lange habe ich gezögert, darüber zu schreiben: Wie es ist, als (junge) Frau in der Politik aktiv zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen. Am liebsten würde ich das Thema beiseiteschieben und mich auf inhaltliche Diskussionen fokussieren. Doch wie viele andere werde ich immer wieder, allem voran, darauf reduziert: aufs Frausein, aufs Frausein als junge Frau.
Dass Frauen in der Schweizer Politik nicht gleichberechtigt sind, hängt unter anderem damit zusammen, dass Frauen in politischen Ämtern untervertreten sind. Und überhaupt noch nicht lange mitspracheberechtigt sind – Stichwort nationales Frauenstimmrecht erst seit 1971.
Aktuell besetzen Frauen 38,5 Prozent der Sitze im Nationalrat und 34,8 Prozent der Ständeratssitze. In den Kantonsregierungen und -parlamenten sind Frauen zu einem ähnlichen Anteil vertreten. Und das, obwohl sie rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ausmachen. Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz somit hinterher. Im Ranking der Frauen in nationalen Parlamenten ist die Schweiz auf Platz 35 weltweit.
Was muss sich ändern, damit mehr Frauen in Parlamenten und Regierungen sitzen? Die Stellung der Frau in der Schweizer Demokratie lässt sich mit historischen Gründen erklären. Doch an der Vergangenheit allein kann es nicht liegen.
Eine Herausforderung im Milizsystem ist die Vereinbarkeit eines politischen Amts mit Familie und Beruf, insbesondere weil Frauen im Schnitt mehr Care-Arbeit übernehmen.
Überraschenderweise gibt es im nationalen Parlament mehr Mütter als Väter von minderjährigen Kindern. Doch bei den Aufstiegsmöglichkeiten hapert es mit der Gleichstellung: Während Parlamentsmitglieder im Schnitt zu einer Wahrscheinlichkeit von 13,7 Prozent ein Kommissionspräsidium erlangen, liegt die Chance von Müttern bei 6 Prozent. Für Väter hingegen kann keine solche Benachteiligung festgestellt werden.
Mögliche Erklärungen dafür sind: Die Doppelbelastung als Politikerin und Mutter ist bereits hoch, ohne einen zusätzlichen Posten. Es könnte sich um eine «imputed discrimination» handeln: Mütter werden als weniger belastbar eingeschätzt, weil sie Kinder haben, und deshalb weniger in Betracht gezogen.
Frauen in politischen Ämtern werden anders beurteilt als Männer – kritischer, oberflächlicher und anhand von Stereotypen. Auch ich habe schon erlebt, dass der Fokus mehr auf mein Äusseres statt auf mein Gesagtes gelegt wurde. Einmal wurde meine Akne für einen Fernsehauftritt stark überschminkt. Nach einer halben Stunde Sendezeit bezog sich die Hälfte der Zuschriften nicht auf meine Inhalte, sondern kommentierte, dass ich für eine junge Frau zu stark geschminkt worden sei.
In den Schweizer Medien sind Frauen unterrepräsentiert: In der Politikberichterstattung liegt der Frauenanteil bei 23 Prozent. Auf die Erwähnung einer Politikerin kommt die Nennung von drei Politikern.
Politikerinnen von links bis rechts erleben Hass im Internet und im echten Leben. Gemeindepolitikerinnen sind stärker von verbaler Gewalt und Sachbeschädigung betroffen als ihre männlichen Kollegen. Dabei wird oft auf ihr Frausein gezielt.
In manchen Situationen wird mit mir anders umgegangen, weil ich eine junge Frau bin. Es ist vorgekommen, dass ich in Diskussionen mehrfach unterbrochen wurde und darauf insistieren musste, ausreden zu dürfen. Oder dass an einem Apéro nach einer Veranstaltung ein Mann seine Hand um meine Taille legte oder lange meine Schulter berührte.
All diese Aspekte wägen Frauen ab, bevor sie sich politisch exponieren.
Was braucht es, damit Frauen sich vermehrt politisch engagieren? Hier einige Ansätze:
Sichtbarkeit: Politikerinnen eine Bühne bieten, indem man sie zu Podiumsdiskussionen, Anlässen und Medienauftritten einlädt. So werden Frauen in der Politik sichtbar und können andere Frauen inspirieren.
Mut: Ich höre manchmal von Medienschaffenden, dass Frauen weniger an Live-Diskussionen teilnehmen möchten. Parteien berichten von der Herausforderung, genügend Frauen auf ihre Wahllisten zu bringen. Oftmals braucht es mehr Überzeugungsarbeit, und Frauen sagen weniger schnell zu. Das erscheint logisch angesichts der oben genannten Herausforderungen, mit denen eine Frau in der Politik konfrontiert ist. Trotzdem ist es wichtig, dass Frauen Mut fassen und sich exponieren für Anliegen, die ihnen wichtig sind. Denn das Engagement in der Politik trägt zu einer Veränderung bei.
Rücksicht: Die Nachteile für Politikerinnen sollten berücksichtigt werden, wenn man Frauen ins Boot holen will. Wenn zum Beispiel bereits bekannt ist, dass Frauen sich eine Kandidatur tendenziell länger überlegen, kann man als Partei frühzeitig Aufrufe starten und Frauen gezielt unterstützen.
Verbünden: Frauennetzwerke und Initiativen wie «Alliance F» oder «Helvetia ruft!» können den Unterschied machen.
Frauenquoten? Zum Schluss das wohl umstrittenste Mittel der Frauenförderung: Quoten. Ich war mit 16 Jahren zum ersten Mal eine Quotenfrau, und es fühlte sich nicht gut an. Gleichzeitig können Quoten helfen, die männlichen Netzwerke und gläsernen Decken aufzubrechen. Das kommt uns allen zugute, denn gemischte Regierungen und Unternehmen sind nachweislich erfolgreicher. Beispielsweise zeigen in Basel-Stadt gesetzliche Frauenquoten einen positiven Effekt.
Diese (nicht abschliessende) Aufzählung zeigt: Wir haben einen Weg vor uns. Doch es können alle zur Veränderung beitragen.
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: