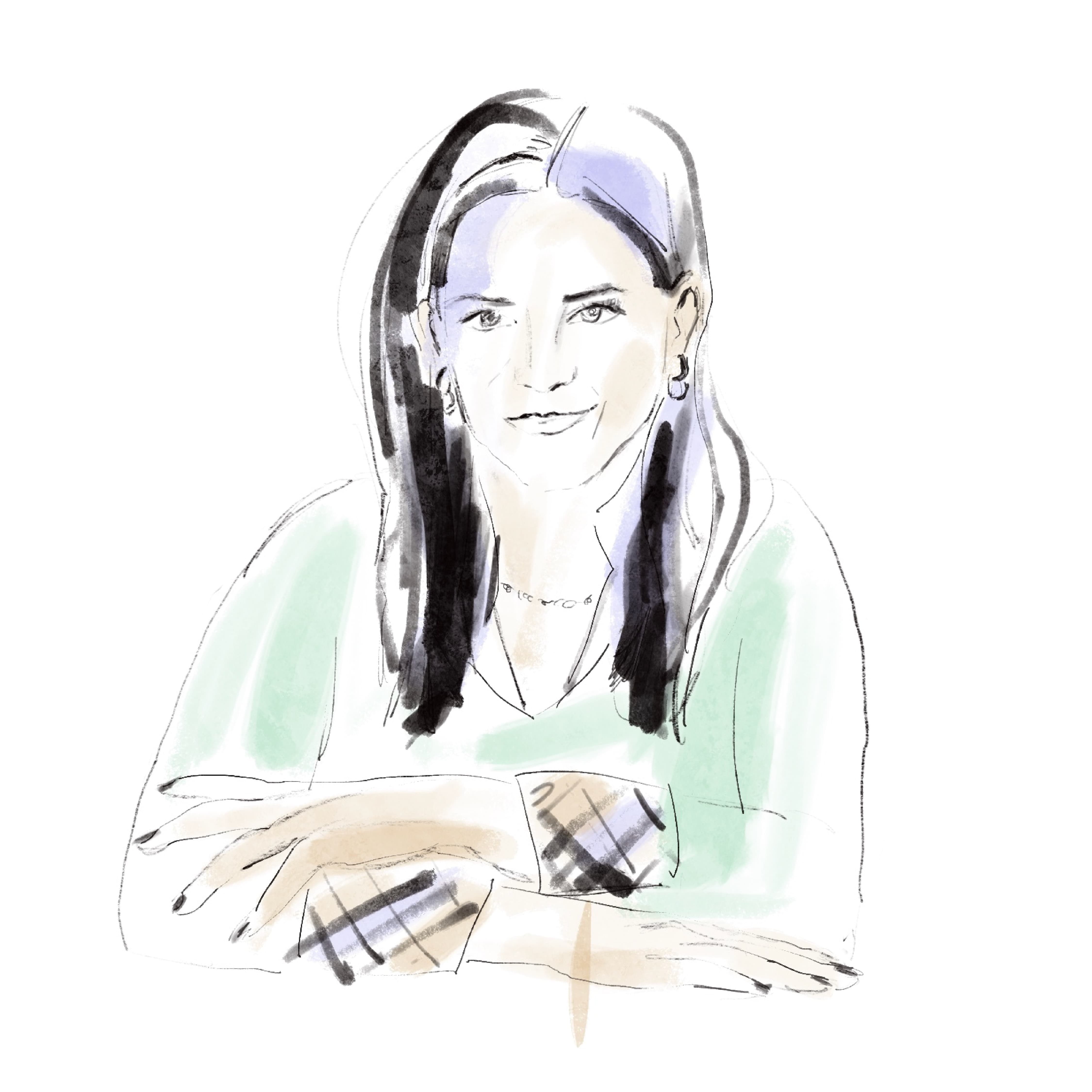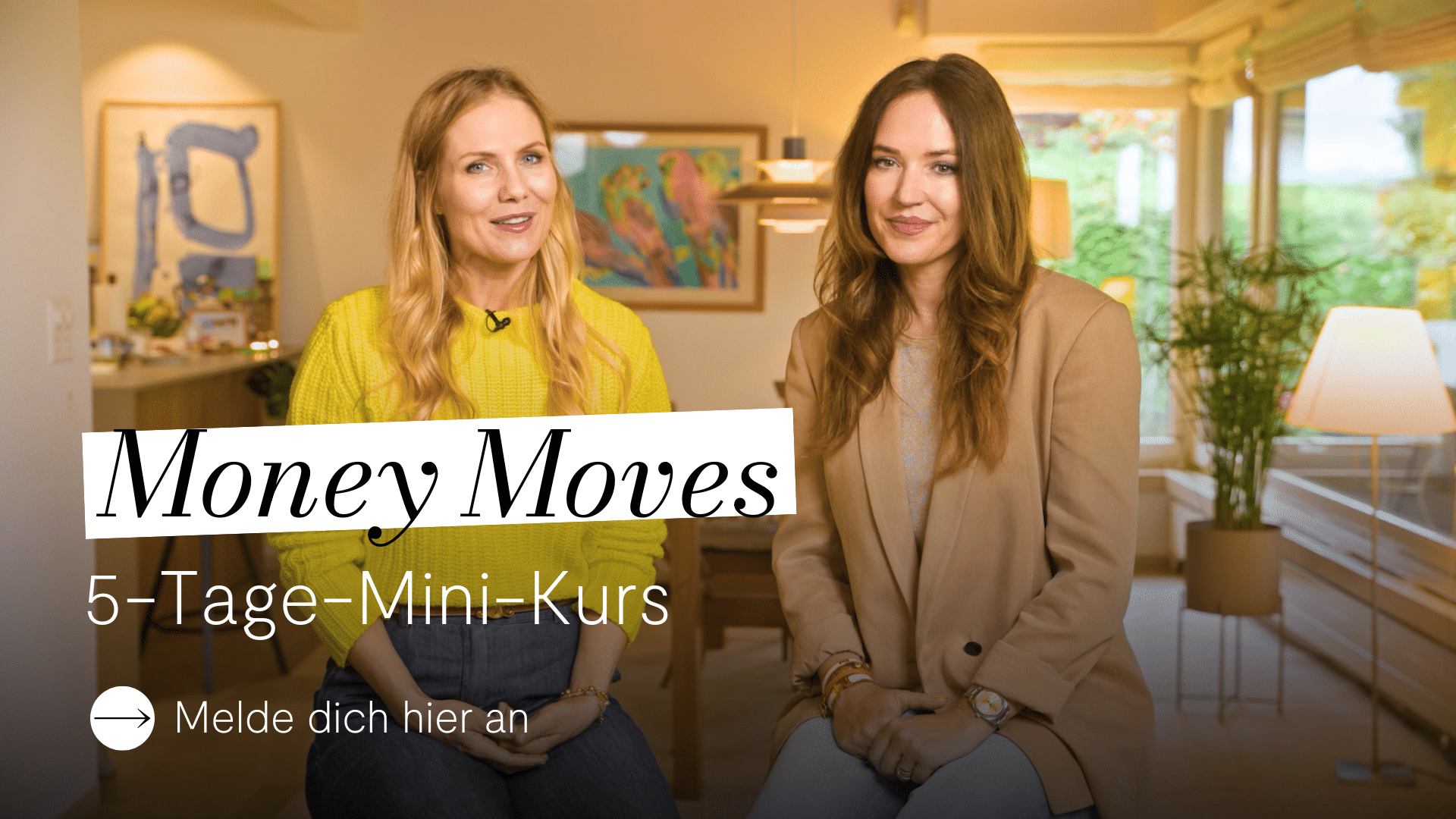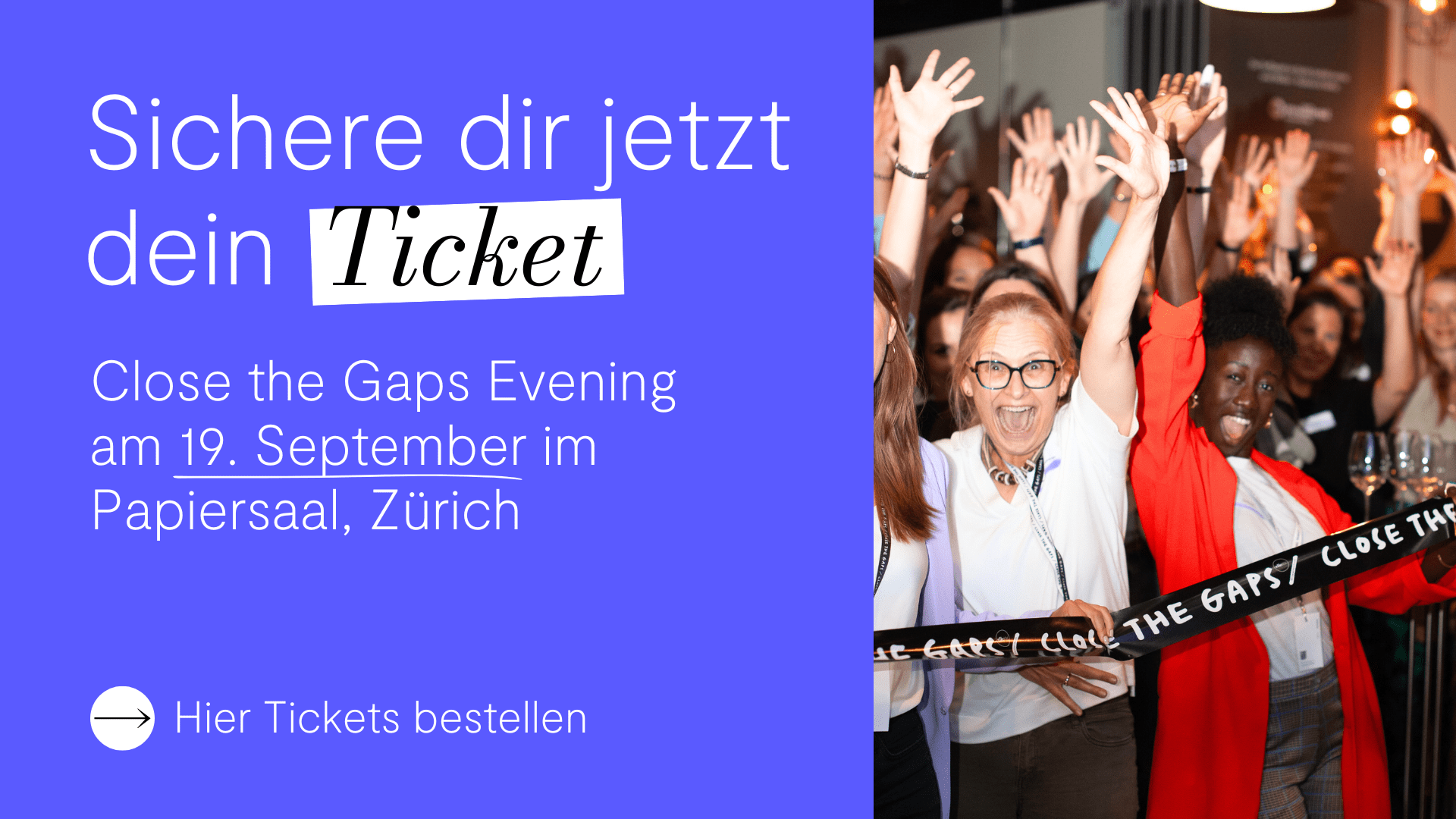Goodbye SRF Kultur, tschüss Zivadiliring, adieu «Me, Myself and Why», bye Gesichter & Geschichten. Zudem Sparübung bei Swissinfo. Im vergangenen halben Jahr wurde bei der SRG öfter der Rotstift gezückt – insbesondere bei Angeboten, die (junge) Frauen ansprechen.
Die meisten SRF-Formate, die ich regelmässig konsumiert habe, gibt es in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. Ich bin auf andere Angebote ausgewichen, von öffentlich-rechtlichen Medienhäusern im Ausland. Es ist für mich aufwendiger geworden, über Angebote der Schweizer Kulturszene informiert zu bleiben. Der wertvolle Safe Space von «Me, Myself and Why» etwa ist komplett weggefallen.
Abgesehen von «@srfnews», Swissinfo und der Arena hat das SRF für mich kaum noch etwas zu bieten. Man könnte denken, für mich sei der Moment gekommen, den öffentlich-rechtlichen Medien den Rücken zu kehren. Doch dieser Schluss greift zu kurz.
Ein Blick über meinen eigenen Tellerrand verdeutlicht: Gerade in Zeiten, in denen vielerorts die Rechte von Frauen und Minderheiten unter Druck geraten und Rechtspopulismus wieder salonfähig wird, halte ich es für wichtig, sich für öffentlich-rechtliche Medien stark zu machen. Diese sind die Grundlage für eine stabile Demokratie.
Untersuchungen zeigen, dass Länder mit starken öffentlich-rechtlichen Medien weniger anfällig und sogar widerstandsfähiger gegen Online-Desinformation sind, etwa Länder Nordeuropas. Das Gegenbeispiel: Die USA sind aufgrund ihres schwachen öffentlich-rechtlichen Rundfunks und einer fragmentierten Medienlandschaft besonders anfällig für Fake News.
Dieser Effekt lässt sich folgendermassen erklären: Gut finanzierte und in allen Landesteilen verbreitete öffentlich-rechtliche Medien beeinflussen die Medienlandschaft eines Landes, indem auch die anderen Medienhäuser mehr für eigene Inhalte ausgeben und die Berichterstattung insgesamt sachlicher, seriöser und qualitativ besser ausfällt – eine Win-win-Situation. Je grösser das Wissen der Bürger:innen ist, desto weniger sind sie anfällig für Desinformation. Auch als gut informierte Person erscheint es mir unmöglich, angesichts hochwertiger KI-Inhalte mit Sicherheit zwischen echt und fake unterscheiden zu können.
Bedeutend finde ich, dass gerade die Schweiz mit ihrem direktdemokratischen System, in dem die Bevölkerung regelmässig über Sachvorlagen abstimmt, ein geeignetes Ziel für Beeinflussung sein kann – so hält es der Bundesrat fest. Insbesondere Russland betreibt seine Beeinflussungsaktivitäten unter anderem in der Schweiz mit dem Ziel, die westlichen Demokratien zu destabilisieren und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.
Der Einfluss von falschen Informationen ist nicht zu unterschätzen. Das World Economic Forum stuft Miss- und Desinformation als bedeutendstes kurzfristiges globales Risiko ein – noch vor extremen Wetterereignissen, bewaffneten Konflikten zwischen Staaten, gesellschaftlicher Polarisierung und Cyberkriegsführung.
Angesichts der Informationsflut, der wir tagtäglich ausgesetzt sind, empfinde ich die Realität hinter dieser Einschätzung als besorgniserregend. Bereits für mich – die eine Matura hat, studiert und sich divers informiert – ist es eine Herausforderung, täglich zwischen Fakten, Meinungen und Fake News zu unterscheiden. Für Kinder und Jugendliche, die sich ab jungem Alter in der digitalen Welt bewegen – teilweise nur mangelhaft beaufsichtigt und begleitet –, scheint mir diese Aufgabe schlicht unmöglich.
Dieses Risiko von Desinformation für unsere Demokratie betrifft auch die Gleichstellung. Denn eine hohe Demokratie ist eine notwendige Voraussetzung, damit ein höheres Mass an Gleichstellung und Sicherheit für Frauen überhaupt möglich ist. Spannend finde ich: Alle Länder mit den niedrigsten Werten von Gewalt gegen Frauen sind auch Länder mit einem hohen Mass an liberaler Demokratie.
Nachdem alle meine SRF-Lieblingsformate aus dem Programm genommen worden sind, habe ich – ja, das gebe ich zu – den Sinn der Serafe-Gebühren hinterfragt. Doch mit Blick auf den grösseren Zusammenhang weiss ich: Selbst wenn ich persönlich mich im Moment nur bedingt von den SRG-Angeboten angesprochen fühle, will ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin unterstützen.
Angesichts dieser Faktenlage steht für mich fest: Im Kampf gegen Desinformation brauchen wir starke und vor allem unabhängige öffentlich-rechtliche Medien, weil diese die Medienlandschaft positiv beeinflussen. In der längerfristigen Perspektive geht es um nichts weniger als um unsere Demokratiequalität und Gleichstellung. Und beides ist mir wichtig.
Ich befürworte, dass der Bundesrat Sparmassnahmen bei der SRG umsetzt. Für wichtig zu bedenken halte ich: Bei welchen Angeboten für welche Zielgruppe streicht man konkret? Und was für Konsequenzen hat der Wegfall längerfristig?
Findet einmal ein Backlash bei Demokratie und Gleichstellung statt, lässt sich dieser nicht so einfach rückgängig machen. Lassen wir es nicht so weit kommen.
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: