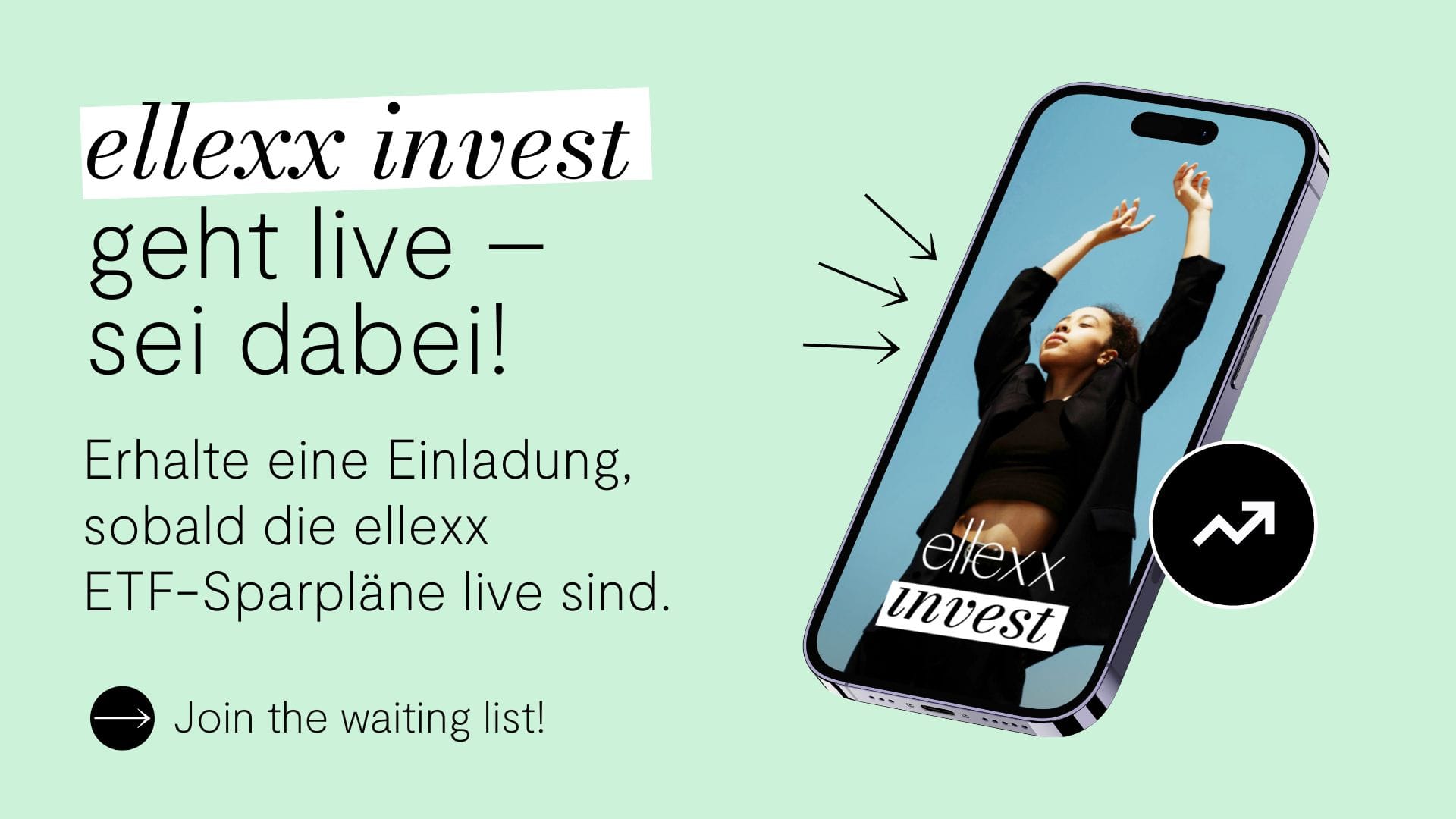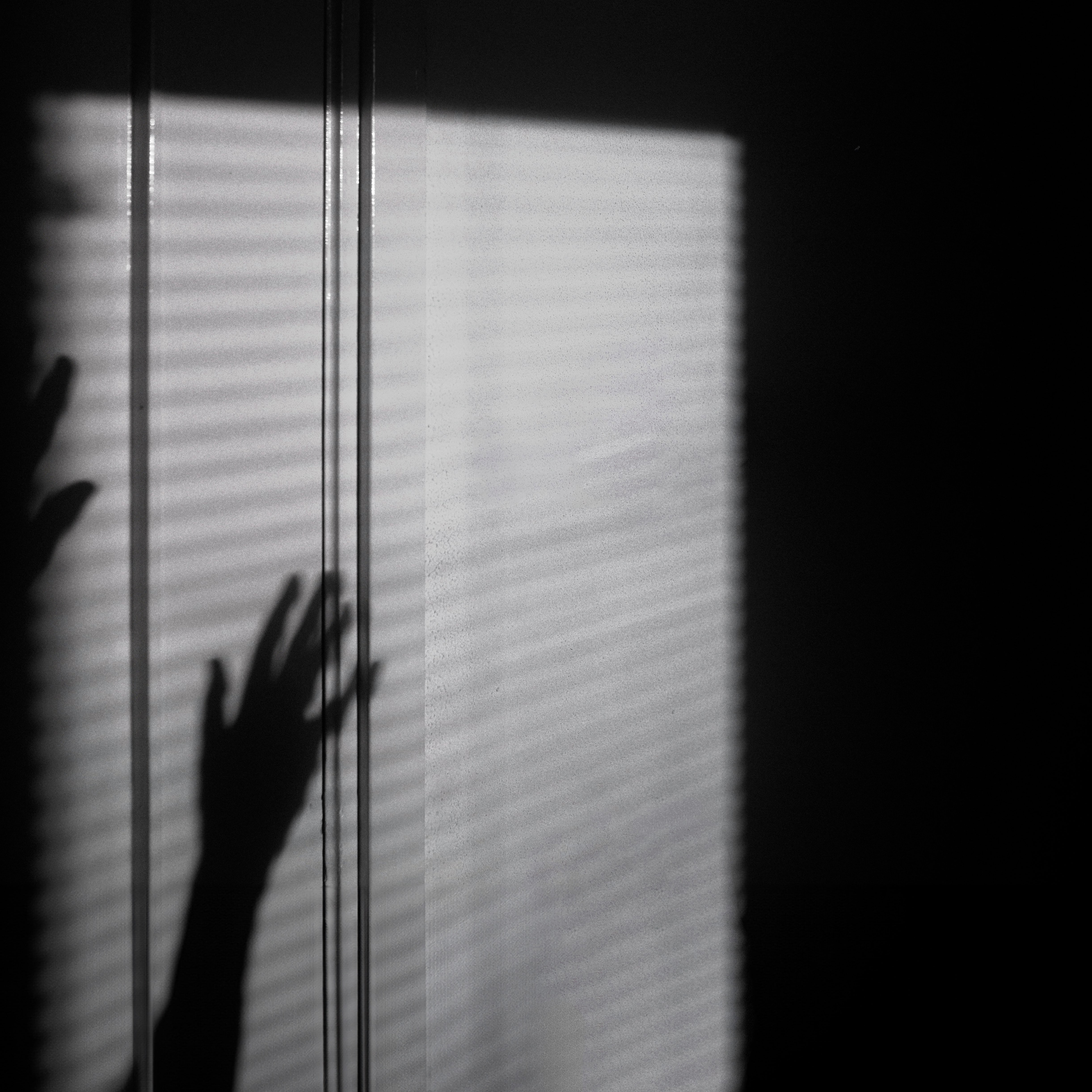Wer sich eine kleine, düstere Schriftstellerinnenkammer vorgestellt hat, liegt falsch. Federica de Cesco wohnt in einer modernen, lichtdurchfluteten Wohnung, mitten in der Stadt Luzern. Sie führt den Besuch ins Wohnzimmer, zeigt auf das braune Sofa und macht es sich darin bequem. Ihr Mann serviert Tee mit Milch. «Er hat mich aus der Küche geschmissen», erklärt de Cesco heiter. Und fügt schulterzuckend hinzu: «Schreiben ist das einzige, was ich kann. Ich bin strohdumm in anderen Sachen.»
Kein Unterschied zwischen starken und normalen Frauen
Bekannt ist de Cesco vor allem für die «starken» Frauenfiguren in ihren Büchern. Sie schreibt über Frauen, die tun, was sie wollen, und die sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschüchtern lassen.
Vom Begriff «starke» Frauen will de Cesco aber nichts hören. Sie sagt: «Eine Frau explizit als stark zu beschreiben impliziert, dass Frauen normalerweise schwach sind. Und das stimmt nicht.» Eine Frau, die gesellschaftlich als rebellisch oder stark verstanden wird, ist für de Cesco einfach eine normale Frau. «Denn Frauen sind von Natur aus stark.»
Deshalb mag sie japanische Mangas lieber als US-amerikanische Heldengeschichten. «Mangas sind gar nicht so übel. Da gibt es Heldinnen, die sich selbst befreien und Jungen retten.» Im Gegensatz zu den amerikanischen Geschichten: «Bei den Amis kommt immer der rettende Mann. Superman und so weiter. Das geht mir auf die Nerven.»
Frauen- versus Männerfiguren
Die Männer von de Cescos Büchern sind anders gestrickt. «Wovor ich mich seit je gehütet habe, sind langweilige Männer», sagt sie. Abseits von starren Geschlechterrollen konzipiert sie Männer, die den Frauen als Persönlichkeiten ebenbürtig sind. Und doch: «Attraktiv müssen sie sein. Sonst interessiert es die Leserinnen nicht.» Sie schmunzelt.
Männerfiguren interessieren de Cesco eigentlich mehr als Frauen, sagt sie und nippt an ihrem Tee. Ein paar Momente lang ist es still, auch von draussen dringt kein Ton in die Stube. «Aber meine Bücher über Männer verkaufen sich nicht», sagt sie und meint damit «Die neunte Sonne». Die Hauptfigur, ein Deutscher, gerät im zweiten Weltkrieg in japanische Gefangenschaft. Er lernt dort einen Samurai, einen japanischen Krieger, kennen und beschliesst am Ende, in Japan zu bleiben. «Der Deutsche ist nicht gerade sympathisch, und für den alten Samurai haben sich die Leser:innen wohl nicht interessiert», meint de Cesco dazu. «Ein junger Samurai wäre vielleicht besser angekommen bei den Leser:innen.»
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: