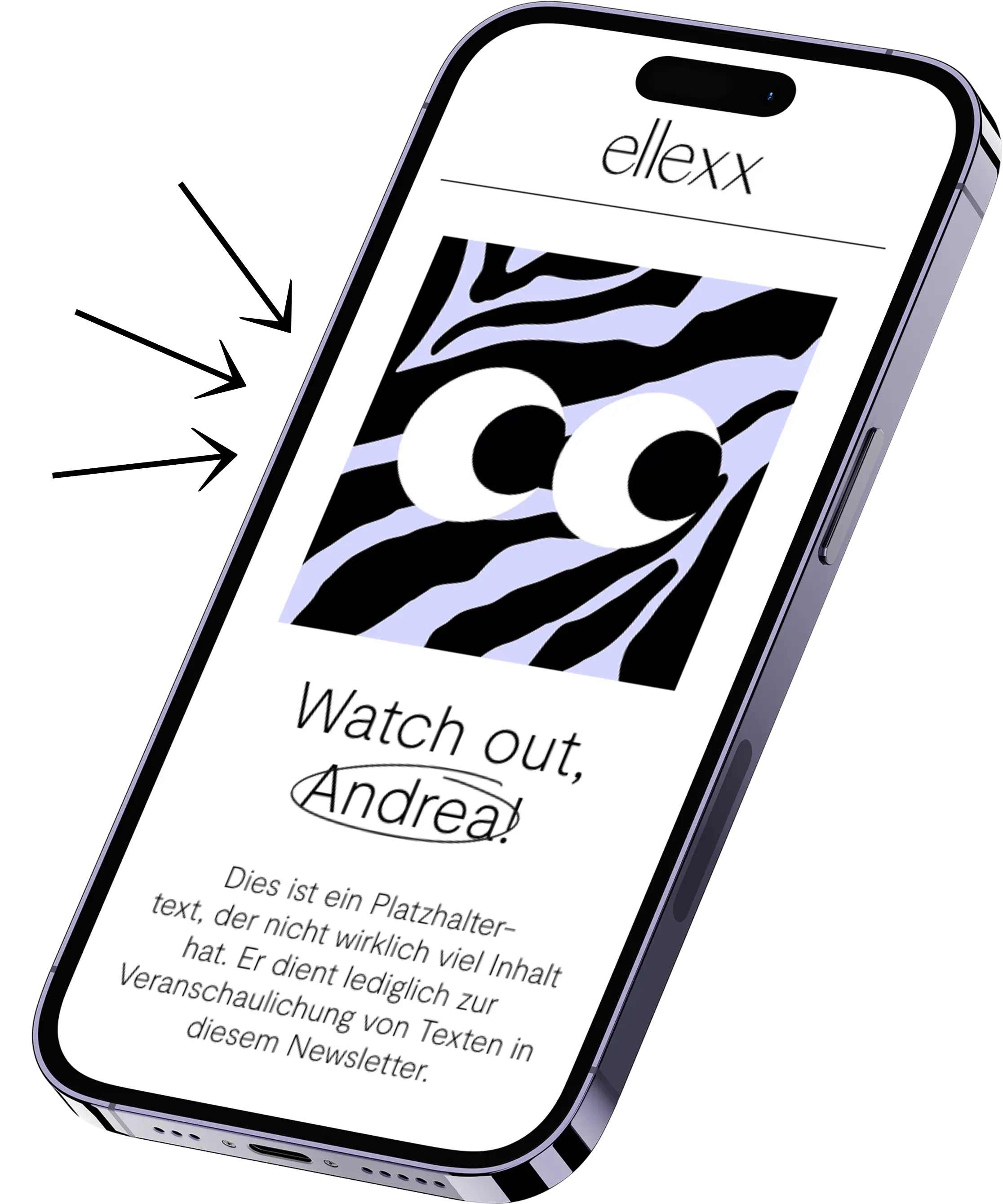Wer verdient, wer versorgt? Warum Gleichberechtigung in der Schweiz blockiert bleibt

Gerade nach der Geburt eines Kindes verfestigen sich traditionelle Rollenmuster bei Paaren in der Schweiz. Er arbeitet Vollzeit, sie reduziert oder steigt ganz aus. Nicht, weil beide das so wollen – sondern weil Politik und Gesellschaft ihnen kaum eine Wahl lassen.
Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, ungleiche Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit – die Probleme sind seit Jahren bekannt. Und trotzdem bewegt sich wenig. In der Schweiz sind die Lücken besonders hartnäckig. Nicht, weil Frauen und Männer sich das wünschen, sondern weil politische und gesellschaftliche Alternativen blockiert sind. Die Schweiz dümpelt seit 2016 im «Glass-Ceiling Index» auf Platz 26 von 29 OECD-Ländern. Weltspitze? Weit entfernt.
Männer arbeiten, Frauen versorgen
Unsere Analyse von zwei Jahrzehnten Daten aus dem Schweizer Haushalt-Panel (2002–2020) zeigt: Viele Paare halten an der traditionellen Arbeitsaufteilungen fest. Männer verdienen hauptsächlich das Geld, Frauen kümmern sich neben einer Teilzeitstelle um Haushalt und Kinder. Die Geburt eines Kindes ist dabei ein entscheidender Wendepunkt: Während viele Paare vorher gleich viel Erwerbsarbeit leisten, reduzieren Mütter nach dem ersten Kind ihre bezahlte Arbeitszeit oder steigen ganz aus. Väter bleiben weiterhin Vollzeit erwerbstätig. Und das bleibt so – selbst wenn die Kinder älter werden.
Unsere Forschung zeigt auch: Paare mit egalitären Werten weichen häufiger von traditionellen Mustern ab. Besonders die egalitären Einstellungen der Frauen beeinflussen, ob und wie sie erwerbstätig bleiben. Gleichzeitig ist es entscheidend, dass der Wert von Sorgearbeit anerkannt wird. Unsere Daten zeigen, dass für eine gerechtere Aufteilung der unbezahlten Arbeit gerade die Überzeugungen der Männer und Väter eine Rolle spielen.
Doch die persönliche Einstellung allein reicht nicht. Das Bundesamt für Statistik (BFS) zeigte kürzlich auf, wie stark die Vorstellungen einer fairen Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit von der gelebten Realität .
Isabelle Zinn & Christina Bornatici
Anders gesagt: Selbst wenn beide Partner es anders wollen, stehen ihnen gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Weg und verhindern eine gleichberechtigte Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit.
Haben Mütter überhaupt eine Wahl?
Die Schweiz unterstützt Familien nur marginal. Erst 2005 wurde ein 14-wöchiger Mutterschaftsurlaub eingeführt – und Väter haben erst seit 2021 überhaupt einen gesetzlichen Anspruch auf zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Zum Vergleich: In Schweden bekommen beide Elternteile zusammen 16 Monate, in Deutschland sind es 14 Monate. Auch die Betreuung von kleinen Kindern ist in der Schweiz im europäischen Vergleich sehr teuer und nicht flächendeckend verfügbar. In vielen Kantonen fehlen ausreichend Kita-Plätze, sodass Eltern auf Grosseltern oder teure private Lösungen angewiesen sind.
Diese strukturellen Hürden sowie kulturelle Erwartungen an die Rolle der Mutter als primäre Betreuungsperson reduzieren Frauen auf ihre Rolle als Mutter und Ehefrau und zwingen viele in Teilzeitmodelle, die nicht immer ihrer ursprünglichen Karriereplanung entsprechen. Gemäss Daten des BFS ist die Erwerbsquote von Frauen in der Schweiz mit 76 Prozent zwar hoch, aber fast 60 Prozent der berufstätigen Frauen arbeiten Teilzeit. Besonders auffällig: Während vor der Geburt eines Kindes über die Hälfte aller Paare Vollzeit arbeitet, sinkt dieser Anteil mit kleinen Kindern auf unter 15 Prozent.
Diese geschlechtsspezifische Aufteilung hat langfristige Folgen: Frauen verdienen über ihr Leben hinweg weniger, haben schlechtere Karriereaussichten und sind stärker von Altersarmut betroffen.
Lösungen für sichtbare Sorgearbeit
Unsere Studie zeigt: Immer mehr Paare hinterfragen traditionelle Rollenbilder und schlagen neue Wege ein. Doch Sorge- und Erwerbsarbeit sind keine privaten Fragen – sie sind zutiefst gesellschaftspolitisch. Solange Care unsichtbar bleibt, gibt es keine echte Gleichstellung. Und wo passende Rahmenbedingungen fehlen, können Paare zwar individuelle Entscheidungen treffen, haben aber keine echte Wahlfreiheit.
Isabelle Zinn & Christina Bornatici
Deshalb ist die Politik gefragt. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Arbeit neu gedacht wird und Fürsorge nicht länger unsichtbar bleibt. Ein solcher Wandel gelingt nur, wenn Sorgearbeit anerkannt und gesellschaftlich aufgewertet wird. Erst wenn ihr Wert kollektiv anerkannt ist, werden Gleichstellung und Chancengleichheit möglich.
Was wir brauchen
Dafür braucht es Strukturen, die es den Menschen erlauben, so zu leben und zu arbeiten, wie sie wollen – statt sich den Zwängen von Gesetzen und Gesellschaft zu beugen. Um den Stillstand zu überwinden und echte Wahlfreiheit zu schaffen, braucht es:
- Kinderbetreuung als gesellschaftliche Aufgabe: flächendeckend, bezahlbar, qualitativ hochwertig.
- Fairer Elternurlaub: ausreichend lang, bezahlt, mit verpflichtendem Anteil für Väter.
- Flexibilität: Elternurlaub muss auch in Teilzeit möglich sein.
- Steuergerechtigkeit: keine Benachteiligung von Doppelverdiener-Familien – Individualbesteuerung statt Ehegattensplitting, Abzugsfähigkeit von Betreuungskosten.
- Mehr Männer in der Care-Arbeit: Strukturelle Hebel wie Arbeitszeitverkürzung, damit Care-Arbeit fair verteilt werden kann.
Letztlich führt die Aufwertung unbezahlter Arbeit zu einer grundlegenden Neubewertung von Arbeit selbst. Und der Frage, was wirklich zu unserem kollektiven Wohlstand beiträgt. Lohn- und Sozialpolitiken beruhen noch immer auf einem traditionellen Modell: dem heterosexuellen Paar, das ein Leben lang zusammenbleibt mit einer klaren Rollenverteilung.
Doch die Formen des Zusammenlebens sind heute vielfältiger geworden. Und das berücksichtigen die heutigen Strukturen zu wenig. Deshalb ist es Zeit, diese Strukturen neu zu denken – für mehr Gerechtigkeit durch echte Wahlfreiheit.
Dieser Gastbeitrag stützt sich auf eine kürzlich publizierte Studie, sowie andere Forschungsschwerpunkte der beiden Autorinnen. Bornatici, C., & Zinn, I. (2025). Beyond tradition? How Gender Ideology Impacts Employment and Family Arrangements in Swiss Couples. Gender & Society, 39(2), 285–320.

Isabelle Zinn ist Professorin für Diversity, Equity & Inclusion und neue Arbeitsformen an der Berner Fachhochschule, Departement Wirtschaft, und assoziierte Forscherin an der Universität Lausanne. Sie forscht zu Themen wie geschlechtsspezifischem Altern am Arbeitsplatz, der Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit sowie der Zentralität von Erwerbsarbeit. Sie ist zudem Co-Leiterin des CAS «DEI durch Organisationsentwicklung» an der BFH.

Christina Bornatici ist Forscherin bei FORS – dem Schweizer Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften – sowie an der Universität Lausanne und Mitglied des Komitees für Geschlechterforschung der der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie. Ihre Arbeiten befassen sich hauptsächlich mit Fragen der Geschlechtergleichstellung in der Schweiz, mit einem besonderen Interesse an Einstellungen zur Gleichstellung sowie an der Aufteilung der Arbeit.