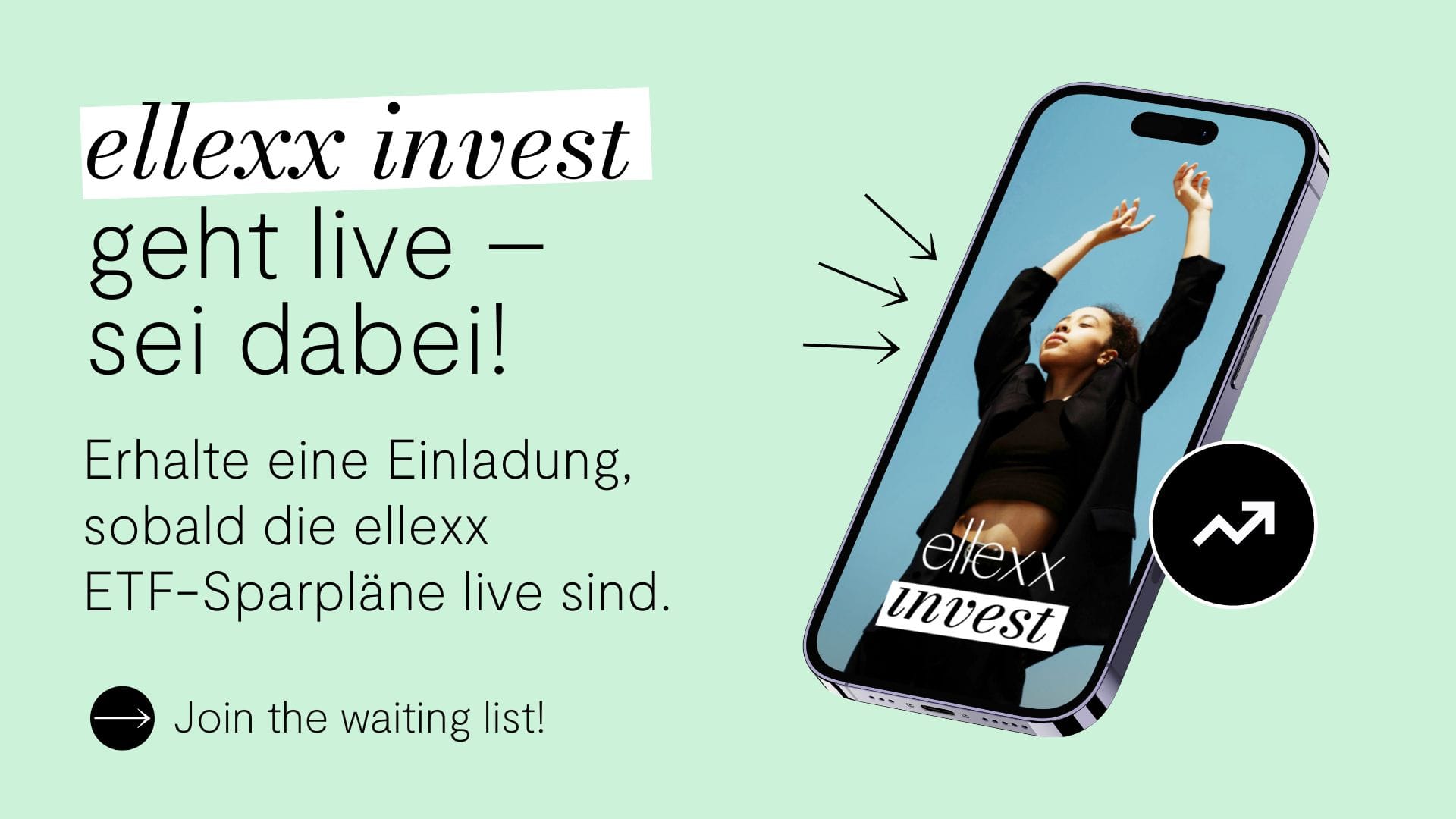Du bist einen Schritt weiter als viele andere. Nicht nur hast du dich intensiv mit dem Thema Investieren beschäftigt, du kennst auch die Grundlagen eines breit diversifizierten ETF-Portfolios. Unterschiedliche Anlageklassen, Regionen oder Sektoren sind für dich keine Fremdwörter mehr. Darauf bauen wir hier auf und zeigen dir, wie du dein Portfolio als Anlegerin noch stabiler, smarter und zukunftssicherer gestalten kannst.
Ausschüttend oder thesaurierend?
Eine Entscheidung, die du als Investorin bei der Auswahl deiner ETFs treffen musst, betrifft die Art der Ausschüttung von Erträgen in Form von Dividenden (bei Aktien) oder Zinsen (bei Obligationen). Bei ETFs unterscheidet man zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Varianten.
Bei ausschüttenden ETFs, häufig auch mit distributing (DIST) gekennzeichnet, erhältst du Dividenden und Zinsen regelmässig direkt auf dein Konto ausgezahlt. Was du mit diesen Erträgen machst, ist dir überlassen: Du kannst sie wieder investieren oder als zusätzliches Einkommen nutzen. Ausschüttende ETFs sind vor allem dann spannend, wenn du dir ein zusätzliches passives Einkommen aus deinen Anlagen wünschst, zum Beispiel in der Pension. Gleichzeitig verlangsamt sich durch die Ausschüttung dein Vermögensaufbau, weil deine Rendite nicht reinvestiert wird. Auf eigene Initiative kannst du auch bei ausschüttenden ETFs die Erträge erneut investieren, das ist aber häufig mit proportional hohen Kosten verbunden.
Falls du dich noch im Vermögensaufbau befindest und langfristig denkst, eignen sich deshalb thesaurierende ETFs. Bei thesaurierenden ETFs, mit accumulating (ACC) markiert, werden deine Erträge automatisch im ETF wieder angelegt. Dadurch steigt der Wert deiner Investition, und du profitierst noch stärker vom Zinseszinseffekt.
Aus steuerlicher Sicht wichtig: In der Schweiz musst du Dividenden und Zinsen in beiden Fällen als Einkommen versteuern, egal, ob sie ausgeschüttet oder thesauriert werden.
Physisch oder synthetisch?
Eine weitere Entscheidung bei der ETF-Auswahl betrifft die Art, wie ein Index nachgebildet wird. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten: physische und synthetische ETFs.
Bei physischen ETFs kauft der ETF die im Index enthaltenen Wertpapiere tatsächlich, entweder vollständig oder teilweise durch eine repräsentative Auswahl. Das bedeutet: Wenn du zum Beispiel in einen SMI-ETF investierst, hält der Fonds die SMI-Unternehmen tatsächlich im Portfolio. Physische ETFs sind besonders transparent, weil du genau weisst, welche Titel enthalten sind. Weiter hast du bei physischen ETFs kein sogenanntes Gegenparteirisiko.
Ein solches hast du hingegen bei synthetischen ETFs. Synthetische ETFs replizieren den Index über sogenannte Swaps, also Tauschgeschäfte mit Banken. Der ETF hält dabei nicht die tatsächlichen Wertpapiere, die in einem Index enthalten sind, sondern stellt die Wertentwicklung des gewünschten Index durch den Swapvertrag sicher. Der Vorteil: Synthetische ETFs können kostengünstiger sein und exotischere Märkte wie Rohstoffe präziser abbilden. Der Nachteil: Es besteht ein Gegenparteirisiko (auch Kontrahentenrisiko genannt): Falls die Bank im Swap ausfällt, gibt es für die Anleger:innen ein Verlustrisiko.
Genau deshalb wurden synthetische ETF in den letzten Jahren scharf kritisiert. Der Trend geht deshalb immer mehr in Richtung physisch replizierende ETFs – an der Schweizer Börse SIX sind sie inzwischen klar in der Überzahl.
Hedging: Ja oder nein?
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der ETF-Auswahl ist die Frage nach dem Währungsrisiko. Viele ETFs bilden Indizes ab, die nicht in Schweizer Franken notiert sind – zum Beispiel in Euro oder US-Dollar.
So funktioniert’s: Kaufst du mit 10’000 Franken einen ETF auf den amerikanischen Index S&P 500, wird dein Geld zuerst in US-Dollar gewechselt. Steigt der Kurs des S&P 500 und der US-Dollar gegenüber dem Franken, profitierst du doppelt: vom Kurszuwachs des Index und vom Wechselkurs. Wertet sich der Schweizer Franken aber auf, kann dein Investment an Wert verlieren, selbst wenn der S&P 500 gestiegen ist.
Bei ungehedgten ETFs trägst du dieses Währungsrisiko ganz. Das kann sich positiv auswirken, wenn der Wechselkurs zu deinen Gunsten läuft, oder deine Rendite drücken, wenn der Schweizer Franken zulegt oder die Fremdwährung schwächelt. Auf lange Sicht gleichen sich Währungsschwankungen oft aus, kurzfristig können sie dein Portfolio aber stark bewegen.
Gehedgte ETFs, meist mit Hedged CHF oder Currency Hedged gekennzeichnet, sichern Währungsschwankungen ab. Dein ETF bildet den Index dann unabhängig vom Wechselkurs ab. Das sorgt für mehr Stabilität und Planbarkeit, kostet aber zusätzliche Gebühren. Du bekommst sozusagen die reine Aktienperformance, ohne dass Wechselkurse deine Rendite verfälschen.
Fazit: Hedging ist vor allem dann sinnvoll, wenn du Risiken reduzieren möchtest, dein Anlagehorizont kürzer ist oder du mit einer Aufwertung des Frankens rechnest.
Rebalancing: Nötig oder nicht?
Für dein Gesamtportfolio solltest du dich auch mit der Frage nach dem Rebalancing befassen, also ob und wie du dein Portfolio regelmässig wieder ins Gleichgewicht bringst.
So funktioniert’s: Stell dir vor, dein ursprünglich gewähltes Portfolio besteht zu 70 Prozent aus Aktien-ETFs und zu 30 Prozent aus Obligationen-ETFs. Entwickeln sich die Aktien über die Zeit überdurchschnittlich gut, wächst ihr Anteil schnell auf 80 Prozent oder mehr an. Dein Portfolio ist dann risikoreicher, als du ursprünglich geplant hast.
Bei regelmässigem Rebalancing verkaufst du einen Teil der übergewichtigen Position (z. B. Aktien) und investierst in die untergewichtete Anlageklasse (z. B. Obligationen). So stellst du deine ursprüngliche Strategie wieder her. Der Vorteil: Du kontrollierst dein Risiko konsequent und realisierst sogar automatisch Gewinne.
Ohne Rebalancing lässt du dein Portfolio einfach laufen. Das ist bequemer, kostet weniger Transaktionsgebühren und kann in starken Marktphasen sogar zusätzliche Rendite bringen – allerdings um den Preis eines höheren Risikos, da die Gewichtung immer weiter vom ursprünglichen Ziel abweicht. Häufig erhöht sich aber auch mit zunehmender Erfahrung beim Investieren der Risikoappetit, dann möchtest du vielleicht Marktbewegungen bewusst laufen lassen.
Nachhaltig investieren – aber wie streng?
Auch die Frage der Nachhaltigkeit gehört zu den wichtigen Überlegungen bei der Portfolio-Gestaltung. Viele ETFs tragen heute ein Nachhaltigkeitslabel, meist erkennst du das schon an Titeln wie ESG (Environment, Social und Governance), SRI (Socially Responsible Investing) oder Paris Aligned. Sie alle versprechen, ökologische und soziale Kriterien zu berücksichtigen. Aber nicht alle ETFs sind gleich streng in ihrem Nachhaltigkeitsansatz, weil es momentan noch keine einheitlichen Standards gibt.
So funktioniert’s: Bei ETFs mit ESG-Labeln kommen in der Regel Ausschlusskriterien zum Einsatz. Unternehmen aus Branchen wie Waffen, Kohle oder Tabak werden ausgeschlossen. Wie streng diese Kriterien sind, variiert aber je nach Anbieter. Ein klassischer MSCI World ETF umfasst rund 1400 Titel – ESG-Varianten enthalten je nach Filter zwischen 1200 und 400 Titel. Das zeigt schon, wie stark die Nachhaltigkeitsansätze variieren können.
Die strengen ESG-ETFs kombinieren Ausschlüsse mit dem Best-in-Class-Ansatz: Unternehmen einer Branche mit den besten Nachhaltigkeitswerten bleiben im Index. Dennoch gilt auch da: Der Ansatz ist nicht perfekt, es gibt keine einheitlichen Messgrössen, und nicht jeder Anbieter prüft beispielsweise komplette Lieferketten.
Ein wenig Orientierung bietet die SFDR-Klassifikation der EU: ETFs, die Artikel 8 tragen, berücksichtigen ökologische oder soziale Kriterien (Standard bei ETFs mit ESG im Titel). Artikel 9-ETFs hingegen verfolgen messbare Nachhaltigkeitsziele. Bei Aktien-ETFs sind diese aber noch sehr selten, noch eher findet man sie bei Obligationen.
Wichtig ist: Nachhaltig investieren heisst, bewusst zu entscheiden, wie streng die Kriterien sein sollen: Breit gestreute ETFs mit Ausschlusskriterien sind nachhaltiger als klassische ETFs, aber ähnlich diversifiziert. ETFs mit strengen Filtern haben teils messbare Nachhaltigkeitsziele, aber weniger Titel und damit weniger Streuung.
Zum Schluss: Disziplin oder Timing?
Nach all den Entscheidungen – ausschüttend oder thesaurierend, physisch oder synthetisch, gehedgt oder ungehedgt, nachhaltiger oder klassischer Ansatz – bleibt die vielleicht wichtigste Frage: Musst du den perfekten Einstiegszeitpunkt beim Investieren erwischen?
Nein. Niemand weiss, wann der beste Moment ist.
Wenn du versuchst, den richtigen Zeitpunkt zu finden, verpasst du wertvolle Zeit für den langfristigen Vermögensaufbau. Zeit ist die beste Freundin der Anlegerin. Deshalb ist die bessere Strategie Disziplin. Mit einem ETF-Sparplan nimmt das Timing-Risiko ab: Du investierst regelmässig, profitierst vom Cost-Average-Effekt, und dein Geld bleibt auch in turbulenten Phasen investiert. So baust du Schritt für Schritt Vermögen auf, ohne dich von Emotionen oder Schlagzeilen leiten zu lassen.
Dazu ein Beispiel: Angenommen, du investierst 200 Franken pro Monat in einen MSCI World ETF. Nach 20 Jahren und einer durchschnittlichen Rendite von 7 Prozent pro Jahr ergibt das rund 102’000 Franken Vermögen – bei Einzahlungen von 48’000 Franken.
Somit kennst du fortgeschrittene Anlegerin jetzt die wichtigsten Stellschrauben für dein ETF-Portfolio. Ob Ausschüttung, Replikation, Währungsabsicherung, Rebalancing oder Nachhaltigkeit – jede Entscheidung macht dein Portfolio individueller. Die wichtigste Zutat für langfristigen Erfolg bleibt übrigens immer gleich: dranbleiben.

Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: