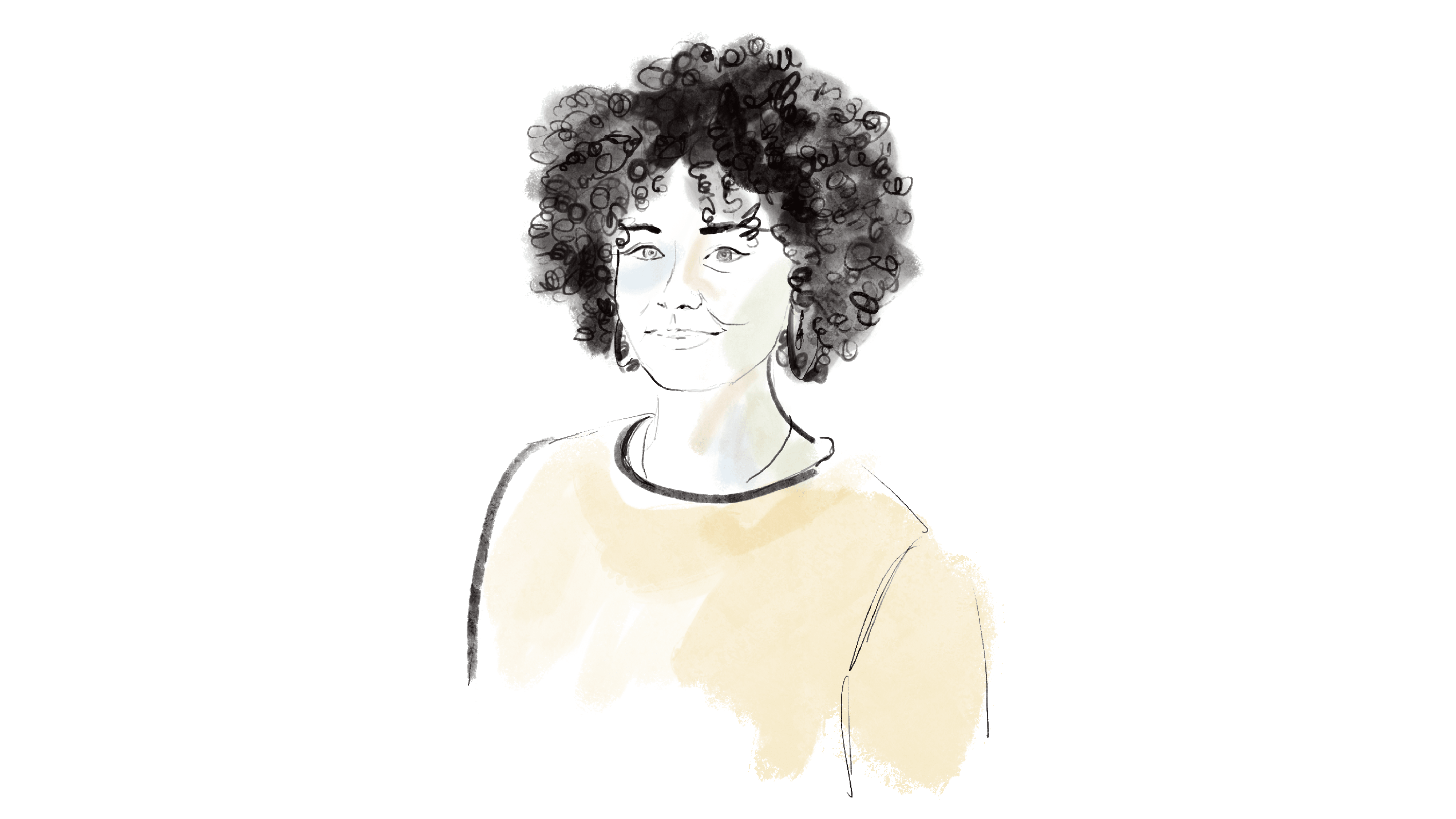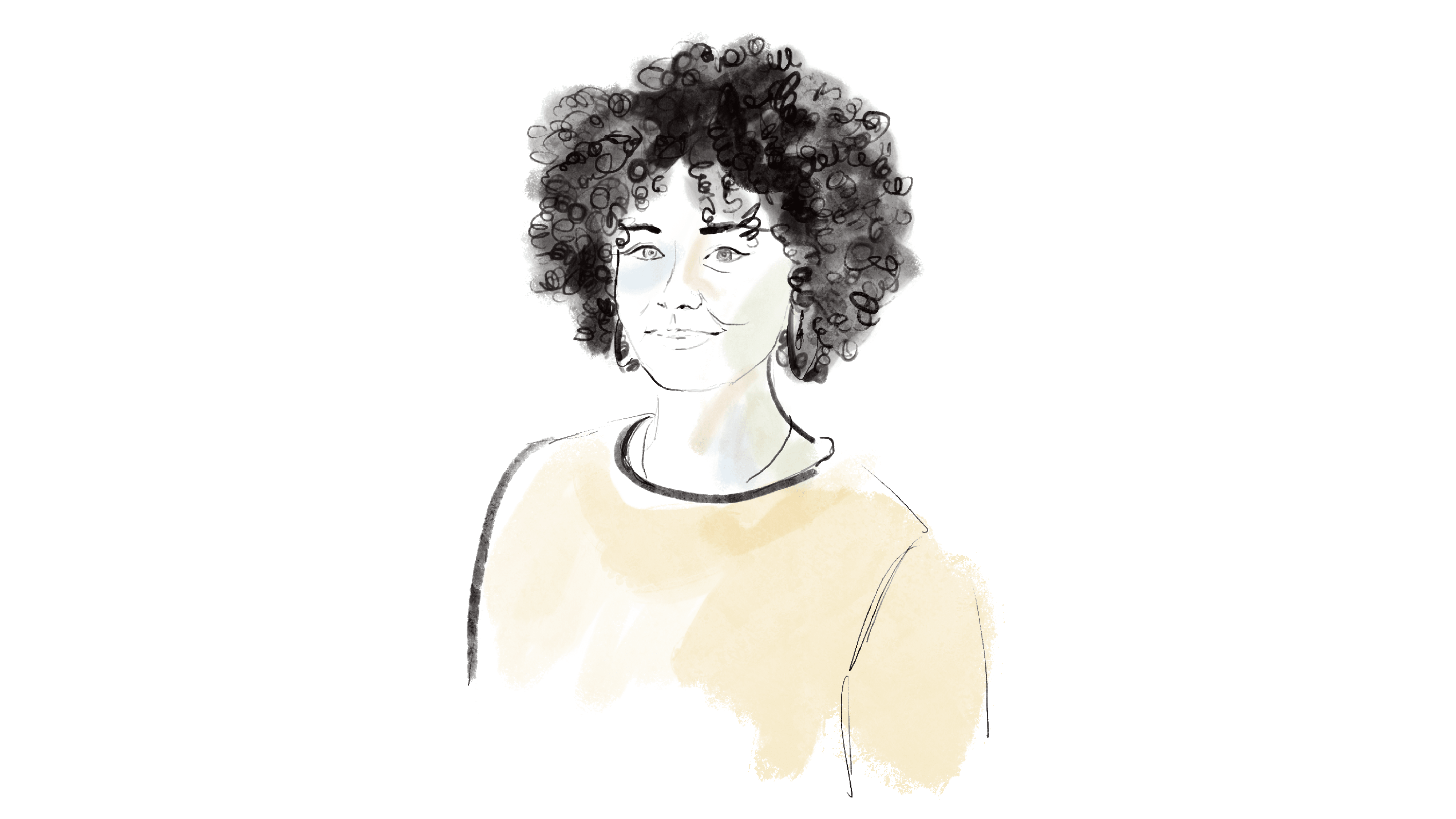Ich hatte diese Woche mal wieder viel damit zu tun, zu erklären, warum meine Arbeit es verdient, bezahlt zu werden. Der Auslöser: Vor wenigen Wochen hat die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) den neuen Rassismusbericht veröffentlicht. Das sind Momente, in denen unser Wissen als Rassismus-Expert:innen besonders gefragt ist. Aber hauptsächlich eben nur dann. In den Tagen nach der Veröffentlichung habe ich viele Anfragen erhalten. Meistens möchten mich die Anfragenden kurz anrufen diese Woche, morgen oder am besten noch am selben Nachmittag treffen, damit wir uns über den Bericht oder das Thema austauschen können.
Ob Medien, Unternehmen, Veranstalter:innen oder Vereine – sie alle erklären mir, dass es sich bei unserer «Zusammenarbeit» um einen guten Zweck handelt. Teilweise sagen sie auch, dass sie sich ehrenamtlich mit Themen wie meinem beschäftigen. Aber Rassismus ist nicht «mein» Thema. Es ist ihre Aufgabe, dagegen zu kämpfen, genauso wie es meine ist. Der Grund, warum sie mir alle sagen, dass es um diesen guten Zweck geht, ist simpel: Die meisten wollen mein Honorar verhandeln.
Natürlich mag es sein, dass solche Tätigkeiten aus Ehrenamtlichkeit gemacht werden, dass es Menschen gibt, die sich aus reiner Liebe zum Nächsten engagieren. Das tun zu können, hat aber oft weniger mit Liebe und mehr mit Privilegien zu tun. Für mich stellt das nichtbezahlte Aufklären rund um Rassismus, Sexismus oder andere unterdrückerische Gesellschaftsformen keine Ehre dar, sondern Ausbeutung. Meine Arbeit ist nicht wirklich ehrenvoll. Sie ist notwendig, und ich habe das Privileg, sie zu tun, und viele haben das Privileg, sie nicht tun zu müssen.
Es macht mich fertig, mit meinen Auftraggeber:innen ständig verhandeln zu müssen. Sie sitzen, während sie mir schreiben, auf ihrem bezahlten Bürostuhl in ihrem bezahlten Büro, trinken ihren bezahlten Kaffee und verhandeln während ihrer bezahlten Bürozeit mit mir, ob ich meine ohnehin schon viel zu niedrigen Preise noch anpassen könnte.
Ein konkretes Beispiel: Ich werde oft zu Podien eingeladen. Die einladende Person bekommt meist Geld dafür, mich anzufragen, oder sie hat einen Job, der es ihr ermöglicht, während ihrer Freizeit ein guter Mensch zu sein. Gleichzeitig findet sie es aber oft schwierig, mir etwas für meine Arbeit zu bezahlen. Ich höre mindestens jede Woche einmal das Argument: «Das Podium wird nur eine Stunde dauern, und du musst dich auch nicht vorbereiten.» Falsch. Ich habe mich 30 Jahre lang vorbereitet, sonst würdet ihr mich ja nicht anfragen.
Ein anderes Beispiel: Bis es zu einer Weiterbildung oder einem Workshop kommt, den ich leite, gibt es oft monatelange Vorbesprechungen mit den Auftraggeber:innen. Diese Vorbereitungszeit ist für meine Auftraggeber:innen in der Regel bezahlte Arbeitszeit. Ich hingegen habe diese Arbeit lange einfach so – unbezahlt – gemacht. Ich musste dafür kämpfen, dass meine ganze Arbeit inklusive der Vorbereitung bezahlt wird. Heute vereinbart meine Mitarbeiterin meine Engagements und verrechnet jede Stunde, auch wenn es nur eine kurze Vorbesprechung ist. Mein Kalender ist voll mit kurzen Vorbesprechungen.
Ein anderes Argument, mit dem man versucht, mit mir zu verhandeln, ist, dass es sich um einen einmaligen Anlass handelt. Für mich sind solche Anlässe nicht einmalig, sie sind mein Beruf. Dann fragt man mich auch, ob ich zumindest die Fahrspesen übernehmen könnte. Warum denn? Ich werde ja nicht abgeholt.
Auch das Argument, dass es sich bei der Auftraggeber:in um eine NGO handle, höre ich regelmässig. Ich bin aber auch nicht staatlich, und ich mache auch keinen Profit. Der Unterschied ist, dass NGOs Spenden- und Fördergelder erhalten und ich nicht. Viele grössere Initiativen, die Förder- und Spendengelder zur Verfügung stellen, verlangen übrigens, dass die antragstellenden Teams ihre Arbeit «ehrenamtlich» machen. Warum? Ehrenamtliche Arbeit würde ja dann bedeuten, dass ein Mensch wohlhabend genug sein muss, um Gutes zu tun. Aber: Auch wer weniger Geld hat, sollte sich «gutes Engagement» leisten können – oft sind es ja auch gerade diese Menschen, die wissen, was soziale Ungerechtigkeit bedeutet. Menschen mit begrenztem Zugang zu Ressourcen oder mit anderen Verpflichtungen sind benachteiligt in Bezug auf ehrenamtliche Arbeit, was zu einer Vertiefung sozialer Ungleichheiten führen kann.
Es sind aber nicht nur Vereine und NGOs, die mit mir verhandeln wollen: Die grössten Schweizer Banken haben mit mir mein Honorar verhandelt, weil es in den entsprechenden Abteilungen nun mal zu wenig Budget für solche Weiterbildungen gab.
Dass ich mich für meine Preise rechtfertigen muss, ist nicht nur eine Zumutung, es ist auch frech. Ich möchte nicht mehr über meine Preise verhandeln. Auch nicht, wenn es für einen guten Zweck ist, oder eben gerade deswegen nicht. Meine Arbeit ist immer für einen guten Zweck.
In welcher seltsamen Welt leben wir, dass es in Ordnung ist, für gute Zwecke keine Löhne zu bezahlen? Ich weiss, in einer kapitalistischen. Aber wie ist es möglich, dass der «gute Zweck» ein Argument ist für geringere Wertschätzung und für weniger Geld? Müssten nicht diejenigen Menschen hohe Gehälter erhalten, die es zum Kern ihrer Arbeit gemacht haben, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu arbeiten? Zudem funktioniert das mit dem «guten Zweck» ja sonst auch nicht. Ich kann meinem Telefonanbieter nicht sagen: «Hey, wir machen hier gute Sachen, wie wäre es, wenn wir nicht fürs Abo bezahlen müssten?» oder bei der SBB anklopfen und sagen: «Ist es in Ordnung, wenn ich das GA nicht bezahle, ich bin meistens für meine Arbeit und damit für gute Zwecke unterwegs?»
Es ist höchste Zeit, dass wir umdenken. Natürlich sollen wir über die Höhe von Gehältern diskutieren, aber wie wäre es, wenn wir da zuerst mal bei Grosskonzernen und gut verdienenden Menschen beginnen würden? Wie wäre es, wenn diejenigen, die über ihre eigene Ausbeutung erzählen und aufklären müssen, nicht auch noch erklären müssen, dass diese Arbeit Wertschätzung und auch finanzielle Wertschätzung verdient? Wie wäre es, wenn Boni an Menschen ausgezahlt würden, die besonders viel für die Gesellschaft leisten? Wenn wir unsere Zeit nicht mit Anträgen verbringen müssten, für die meistens eine Absage kommt, weil nur Ehrenamtsprojekte unterstützt werden?
Es ist nicht einfach, aber ich habe gelernt, darauf zu bestehen, bezahlt zu werden. Auch wenn es nur mal eben für einen Kaffee zum Austausch, einen kurzen Anruf oder eine kurze Einschätzung ist. Grenzen sind entscheidend, um unsere geistige Gesundheit zu erhalten und autonomere und gesündere Beziehungen zu anderen und vor allem zu uns selbst aufzubauen. Ich habe es auf die harte Tour gelernt, und ich muss meine Grenzen jeden Tag wieder markieren. Natürlich wünsche ich mir, eingeladen und angefragt zu werden. Ich möchte nur wie jeder andere Mensch in diesem Land dafür bezahlt werden, ohne meine Bezahlung rechtfertigen zu müssen.
Wir alle können verdammt froh sein, dass es Menschen gibt, die sich gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzen. Und diese Menschen verdienen es, für ihre Arbeit bezahlt zu werden.