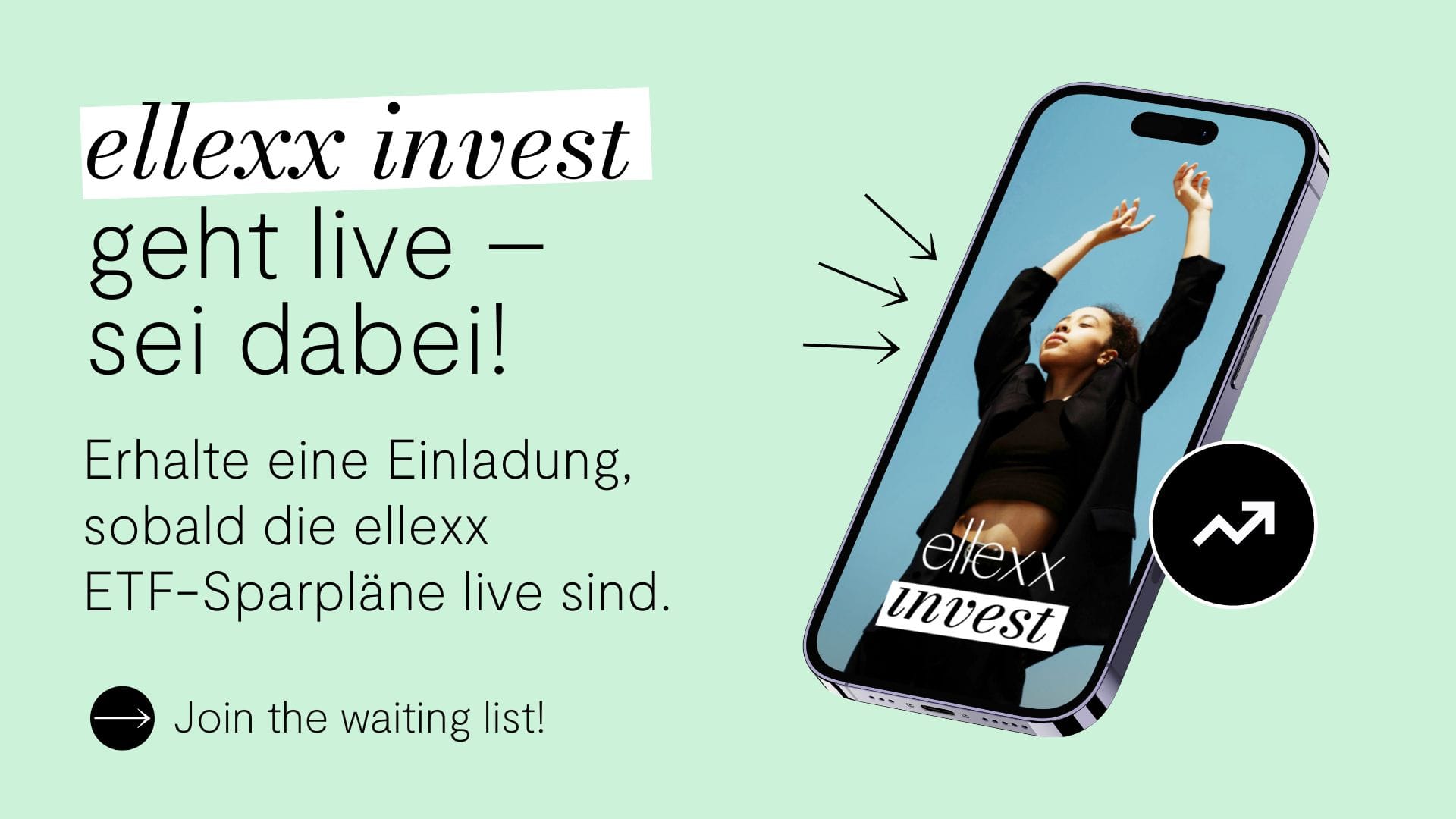Melchior Lengsfeld kommt für das Interview direkt von einem Termin in Bern ins Büro von Helvetas in Zürich. Falls er in Eile ist, merkt man es ihm nicht an. Er ist der Geschäftsleiter von Helvetas, einer Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit.
In den Männerfragen beantwortet Lengsfeld Fragen, welche sonst nur Frauen gestellt werden. Er spricht darüber, warum Armut weiblich ist, wie er mit Kritik zu seinem Äusseren umgeht und warum er es gewagt hat, als Mann in einer weiblichen Domäne Karriere zu machen.
Sie sind Geschäftsleiter von Helvetas. Gäbe es auf der Welt weniger Armut, wenn die Weltordnung von Frauen statt Männern dominiert würde?
Wahrscheinlich schon. Wenn man sich anschaut, wie viele Männer heute autoritäre Fantasien ausleben und dabei von anderen Männern gestützt werden … Unsere Welt wäre friedlicher, wenn Frauen mehr zu sagen hätten. Es sind zwar nicht alle Frauen friedlicher als Männer, in der Tendenz aber schon.
Helvetas leistet Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Was hat Sie in dieses Themenfeld verschlagen?
Ich war damals nach der Schule mit einem Freund in Zentralamerika. Als ich die dortigen Lebensbedingungen sah, merkte ich, dass mich das Thema bewegt. Ich will vor Ort etwas beitragen und nicht nur beobachten.
Es sind doch vor allem Frauen, die sich für soziale Themen engagieren. Ist das nicht ein bisschen zu schwierig für Sie als Mann?
Sich für eine positive Veränderung auf der Welt einzusetzen ist nicht männlich oder weiblich. Ich habe es als Mann nie schwierig gefunden. Früher war die Entwicklungszusammenarbeit ein männerdominierter Sektor, heute arbeiten mehr Frauen in diesem Bereich.
Bekommt Helvetas mehr Spenden von Männern oder von Frauen?
Mehr von Frauen. Bei sozialem Engagement fühlen sich Frauen generell mehr angesprochen. Aber natürlich unterstützen uns auch viele Männer. Einen Beitrag an eine bessere Welt zu leisten ist nicht etwas, das nur Frauen oder nur Männer interessiert, sondern ein menschliches Anliegen.
Spenden Sie selber auch?
Ja klar. Es ist toll zu sehen, was man ermöglichen kann. Schweizer:innen sind sehr grosszügig mit Spenden.
Sind weltweit mehr Männer oder mehr Frauen von Armut betroffen?
Es sind mehr Frauen von Armut betroffen. Frauen geben ihr Einkommen typischerweise für die Familie aus, zum Beispiel für Nahrung, Gesundheitskosten oder Schuluniformen für die Kinder. Männer kaufen sich eher ein Motorrad oder gehen mit Freunden trinken. Man kann diese Tendenz in vielen Gesellschaften beobachten. Wir fördern deshalb auch spezifisch Chancen für Frauen und Mädchen.
Was für Projekte sind das genau?
In Äthiopien oder Nepal zum Beispiel unterstützen wir junge Frauen dabei, einen gut bezahlten Beruf zu wählen, etwa Malerin oder Schreinerin. Zudem fördern wir Kleinunternehmerinnen. In anderen Ländern – wie Guatemala und Tansania – vermitteln wir Wissen, wie sich Frauen politisch engagieren und sich Gehör verschaffen können, beispielsweise durch eine Wahl in den Gemeinderat. Wichtig ist auch, bei den Männern Verständnis dafür zu schaffen, weshalb alle von einer stärkeren Beteiligung der Frauen im wirtschaftlichen und politischen Leben profitieren.
Können Sie als Mann die Dimension der Benachteiligung oder Diskriminierung von Frauen und Mädchen wirklich erfassen?
Sicher viel schlechter als Frauen. Bei den Themen, bei denen es um Frauen und Mädchen geht, müssen deshalb immer Frauen im Team sein. Manche Themen sind schambehaftet. Da ist es einfacher, unter Frauen zu reden. Das Gleiche gilt auch für Männer.
Helvetas will mit ihren Projekten etwas verändern und trägt eine entsprechende Verantwortung. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie als Geschäftsleiter dieser Verantwortung und den Erwartungen gerecht werden können?
Ehrlich gesagt: nein. Denn es geht um Teamwork, und die Umsetzung liegt bei den Länderteams, und somit auch die operative Verantwortung. Als ich damals selber vor Ort arbeitete, spürte ich diesbezüglich mehr Druck. In meiner jetzigen Rolle als Geschäftsleiter bin ich für strategische Entscheidungen zuständig und stelle sicher, dass wir schnell merken, wenn etwas nicht gut läuft.
Das ellexx Team empfiehlt
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: