Filmregisseurin Maja Tschumi empfängt in der Filmgerberei Zürich – der Produktionsfirma, in der sie arbeitet. Sie hat eine ruhige, unaufgeregte Art – eine Gelassenheit, die sofort eine offene und entspannte Gesprächsatmosphäre schafft.
Ein Money Talk über die unsichtbaren Kosten des Kunstschaffens, strukturelle Ungleichheiten in der Filmbranche und den ständigen Balanceakt zwischen kreativer Freiheit und finanzieller Realität.
Alter: 41
Ort: Berlin und Zürich
Beruf: Dokumentarfilmregisseurin, Produzentin
Einkommen: unregelmässig, ca. 2000 im Monat
Schulden: keine
Grösster Ausgabeposten: Reisen und Wohnen
Vermögen: wenige Aktien im Wert von 20000 CHF
Viele glauben, dass Kunst und Geld nicht zusammenpassen – wie siehst du das?
Stimmt schon: Die meisten Künstler:innen haben wenig Geld. Oder sagen wir so, der Teil der Kunstschaffenden, die wirklich gut verdienen, ist klein. Und unter Frauen ist er noch viel kleiner. Und doch, andererseits passt es aber auch sehr gut zusammen: Menschen, die viel Geld haben, haben oft mehr Freiheiten, um Kunst zu machen. Ich habe das Gefühl, es gibt starke Klassenunterschiede in der Kunstwelt. Wer sich durchsetzt, hat oft ein finanzielles Backup oder eine gute Konstellation mit einem Nebenjob.
Du hast vorher gesagt: Frauen verdienen noch immer weniger. Woran liegt das?
In der Filmindustrie gibt es Studien dazu. In der Filmschule sind es oft 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, aber nach dem zweiten Film nimmt der Anteil Frauen in der Regieposition ab. Es hat sich allerdings in den letzten 10 Jahren verbessert und heute nahe an der Parität. Dennoch ist der Kampf um Sichtbarkeit und Gleichbezahlung für Regisseurinnen nachwievor nicht ausgefochten. Die Gründe sind komplex. Es gibt keine Gewerkschaft für Regisseurinnen. Gerade mit Kindern wird es für Regisseurinnen schwierig, konkurrenzfähig zu bleiben. Es fehlt an struktureller Unterstützung. Aber es wurde bereits viel erkämpft.
Du sprichst von Misstrauen gegenüber Frauen in der Branche. Hast du das selbst erlebt?
Ja. Gerade bei meinem neuen Film über den Irak habe ich gespürt, dass es Vorbehalte gab. Ich habe dann einen Teaser gedreht, um zu beweisen, dass ich das kann. Ich bekam dann zwar Vertrauen – aber Frauen müssen das oft stärker erarbeiten, während Männer oft einen Vertrauensvorschuss erhalten.
Wie sieht ein Teaser aus?
Zehn Minuten Filmmaterial vom Irak, um zu zeigen, was wir machen wollen.
Was ist die grösste finanzielle Herausforderung für dich als Regisseurin?
Die Instabilität. Ich bin finanziell total von meinen Projekten abhängig. Bei meinem letzten Film «Immortals» habe ich für Regie und Drehbuch zusammen um die 100'000 Franken bekommen. Ich habe fünf Jahre daran gearbeitet. Nur weil ich in Berlin wohne, kann ich davon leben. Aber es ist ein riesiger emotionaler und existenzieller Stress. Sobald ein Projekt fertig ist, kommt kein Geld mehr rein. Dann ist der Druck da, möglichst schnell ein neues, förderwürdiges Projekt zu haben. Und oft dauert die Recherchephase ein halbes Jahr oder länger, für die man kein Geld bekommt. Es gibt so viele Unsicherheiten, auch weil die Konkurrenz so gross ist.
Was bedeutet für dich finanzielle Unabhängigkeit? Hast du sie?
Zeit zu haben, um Projekte zu entwickeln. Momentan habe ich diese Zeit, weil ich noch als Produzentin arbeite. Und ich habe ein kleines Erbe von meiner Grossmutter, etwa 100'000 Franken. Das gibt mir Sicherheit: Wenn etwas schiefgeht, muss ich nicht sofort meine Wohnung kündigen. Keine Kinder zu haben, ermöglicht natürlich auch mehr finanzielle Unabhängigkeit. Wenn ich nur für mich selbst sorgen muss, finde ich immer irgendeinen Job. Deshalb fühle ich mich momentan relativ frei.
Nun zu deinem neuen Film «Immortals». Die Protagonistin Milo lebt in Bagdad, verkleidet sich als Mann, um sich freier bewegen zu können, und kämpft für Frauenrechte im Irak. Was hat dich daran interessiert? Was hast du für eine Beziehung zum Irak?
Die US-Invasion in den Irak 2003 hat mich unter anderem politisiert. Wie viele habe ich dann nach Jahren Krieg im Irak, vergessen wie es den Menschen im Irak geht. Als ich 2019 in Berlin einen Aktivisten aus Bagdad kennenlernte und er mir von den Jugendprotesten erzählte, konnte ich anknüpfen, war aber auch schockiert, wie wenig wir hier über junge Iraker:innen wissen. Wir haben gemeinsam begonnen, für diesen Film zu recherchieren.
Wie bist du auf Milo aufmerksam geworden?
Es gab ein politisches Momentum im Irak: Die Regierung wurde gestürzt, riesige Proteste brachen aus, vor allem von Jugendlichen. Viele Frauen gingen auf die Strasse und forderten Gleichberechtigung. Ursprünglich wollte ich über einen Mann an der Front berichten, aber dann wurde mir klar, dass ich als Frau ganz andere Konflikte wahrnehme. Ich suchte also gezielt nach einer Frau. Das war nicht einfach. Viele Frauen mit starken Geschichten wollten sich aus Angst vor familiärer Repression nicht öffentlich zeigen. Schliesslich brachte mich eine Freundin mit Milo in Kontakt. Milo wusste, dass es riskant ist, aber sie wollte es trotzdem machen, weil sie den Irak sowieso verlassen wollte. Ihre Geschichte hat mich sofort überzeugt, das Risiko einzugehen. Heute lebt sie in Deutschland.
Hast du dich in Milo wiedererkannt? Du bist ja selbst feministische Aktivistin.
Total. Milo ist zwar ein extremer Fall. Sie musste sich jeden Tag rausschleichen, ihr Vater hätte sie sonst nicht gehen lassen. Sie verkleidete sich tatsächlich als Mann. Es erinnerte mich an Erfahrungen, die ich im Thai-Box machte, und früher in der Punkrock- und Metal-Szenen – oft Männer-Communities. In meiner feministischen Entwicklung musste ich den Gedanken überwinden, dass dort, wo die Männer sind, auch die wichtigen Dinge passieren. Heute sehe ich das anders: Die wichtigen Dinge passieren auch bei uns Frauen. Milo ist für mich ein Archetyp für viele Frauen in männerdominierten Bereichen. Man passt sich an, spielt Rollen – als Überlebensstrategie. Das kenne ich. Sei es beim Boxen oder im Film: Ich habe gelernt, mit einer überwiegend männlichen Branche umzugehen, ohne meine Rolle als Frau zu verleugnen. Milo ist ein radikales Beispiel für viele Frauen mit Ambitionen.
Was war die grösste Herausforderung beim Dreh?
Ganz klar die Sicherheitsfrage – vor allem für Milo. Wenn ich sie einfach mit der Kamera begleitet hätte, wäre vieles unsichtbar geblieben. Ihr grösster Gegner war ihr Vater, der sie auch während des Drehs einmal Zuhause eingesperrt hat. Da wusste ich nicht einmal, ob sie noch lebt. Um diese unsichtbaren Konflikte sichtbar zu machen, haben wir mit Reenactments gearbeitet – nachgestellten Szenen, die reale Erfahrungen emotional verdichten und den inneren Zustand der Figuren auf filmischer Ebene erfahrbar machen. Wir mussten eng mit der irakischen Crew abstimmen, was gezeigt werden darf, damit es für alle sicher bleibt. Milos Familie ist mächtig und hat Verbindungen zu einer Miliz. Das war sehr heikel, vor allem weil wir einen politischen Film gemacht haben.
Und deine Rolle als Frau im Irak?
Anfangs war es schwierig. Aber sobald ich eine Crew hatte, konnte ich alles machen. Wenn du männliche Verbündete hast, fühlt man sich fast stärker als in der Schweiz. Im Irak sind starke Mütter anerkannt. In der Schweiz solltest du starke Mutter und starke Arbeiterin sein – beides gleichzeitig. Im Irak kannst du, wenn du einmal Autorität hast, auch mal laut werden. Anfangs bin ich aber auch in Fallen geraten – Männer, die mir helfen wollten, haben mich auch belästigt. Es gibt keinen funktionierenden Staat, keine Polizei, die du rufen kannst. Man ist Abhängigkeiten ausgeliefert.
Hat dich diese Erfahrung als Regisseurin verändert?
Ja – sehr positiv. Ich habe viel Selbstvertrauen gewonnen. Ich musste mich mit Tod und Gewalt auseinandersetzen, aber auch mit der Kraft der Frauen vor Ort. Es war mental extrem herausfordernd. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt denke ich oft: Wenn mir jemand blöd kommt, dann weiss ich: Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich es kann.
Das klingt sehr bestärkend.
Total. Und es hat mich auch menschlich verändert. Diese jungen Leute im Irak, die so viel riskieren, um für ihre Träume zu kämpfen – das war unglaublich inspirierend. Ich habe oft Angst. Aber ich habe gelernt: Mutig sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst weiterzumachen.
Der Film wurde mit dem Prix de Soleure 2025 ausgezeichnet. War der Erfolg auch finanziell spürbar?
Ja, der Preis ist mit 60'000 Franken dotiert. Die Hälfte ging an mich, die andere an die Produktion. Das gibt mir kurzzeitig Sicherheit. Es gibt mir in der Schweiz Sichtbarkeit und neue Möglichkeiten, auch finanziell.
Hättest du mit einem grösseren Budget etwas anders gemacht?
Ehrlich gesagt: Nein. Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber ich denke, es hat gereicht.
Warst du bei der Umsetzung frei oder gab es Einschränkungen durch Geldgeber:innen?
Ich war völlig frei. Man muss ein Dossier einreichen und sollte nicht zu weit davon abweichen, aber innerhalb dessen hatte ich alle Freiheiten.
Welche Reaktionen wünschst du dir auf den Film?
Ich wünsche mir, dass das Publikum sich wieder mehr für den Irak interessiert. Heute spricht man viel von Angst und Islamophobie. Ich wollte eine Brücke schlagen zu jungen Menschen dort, die uns ähnlicher sind, als wir denken. Gleiche Popkultur, gleiche Online-Communities, gleiche Träume. Ich hoffe, der Film schafft wieder einen emotionalen Bezug zum Nahen Osten.
Hat dich die finanzielle Abhängigkeit in deiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt?
Ja, nach «Immortals» hatte ich das Gefühl, etwas «Poppigeres» machen zu müssen. Etwas, das sich besser verkauft. Ich mache Arthouse, und das ist selten poppig. Deshalb habe ich entschieden, nebenbei als Produzentin zu arbeiten. So bin ich als Regisseurin freier.
Wie bist du in Bezug auf Geld aufgewachsen?
Zuhause haben wir nicht viel über Geld gesprochen. Mein Vater ist Allgemeinarzt. Es war klar: Wir haben genug. Ich bin mit einem stabilen Gefühl aufgewachsen. Meine Mutter hat früh angefangen, mit mir Budgets zu machen. Um Bewusstsein zu schaffen, wie viel wir ausgeben. Das mache ich inzwischen auch wieder. Seit ich in Berlin lebe und etwas stabiler verdiene, will ich schauen, wie ich langfristig planen kann. Meine Ausgaben liegen bei rund 1700 Franken im Monat. Ich bin 40 Prozent angestellt und bekomme 2000 Franken. Ich will endlich auch für die Rente vorsorgen. Das stresst mich, bisher konnte ich das noch nicht.
Ist Investieren ein Thema für dich?
Ich denke manchmal über eine Wohnung in Berlin nach, aber dann bin ich zu faul. Ich habe ganz wenige Aktien von meiner Tante geerbt, aber da bin ich total vorsichtig. Keine Gamblerin.
Hat sich dein Verhältnis zu Geld über die Jahre verändert?
Ich hatte immer eine gewisse Sparsamkeit. Aber bei meinen ersten beiden Filmen hatte ich so wenig Geld, dass es mich schon verändert hat. Ich konnte keine Menschen mehr einladen, nicht mal meiner Nichte eine kleine Reise schenken. Das hat mich traurig gemacht.
Sprichst du mit Kolleg:innen über Honorare?
Sehr offen, ja. Es interessiert mich auch in anderen Branchen, wer wie viel verdient. Ich finde das wichtig. Es ist Teil meiner politischen Haltung. Ökonomische Verhältnisse prägen unser Leben stark. Wenn man weiss, jemand verdient für das Gleiche mehr, kann man gezielter Forderungen stellen. Transparenz ist wichtig.
Was wären deine drei finanziellen Wünsche?
Mein erster Wunsch? Dass mein nächster Film bereits finanziert wäre.
Ist das nächste Projekt denn schon konkret?
Ja, die ersten Entwicklungsschritte sind gemacht – aber noch nicht alles steht. Der Film wird im Jemen spielen.
Oh wow – spannend! (Beide lachen.)
Zweitens: Eine schönere Wohnung, in der ich mich ausbreiten kann. Und drittens... (Überlegt.)
Deine Nichte ausführen?
Ja, genau. Genug Geld, um Kinder, die nicht meine sind, zu verwöhnen.



Das ellexx Team empfiehlt
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage:

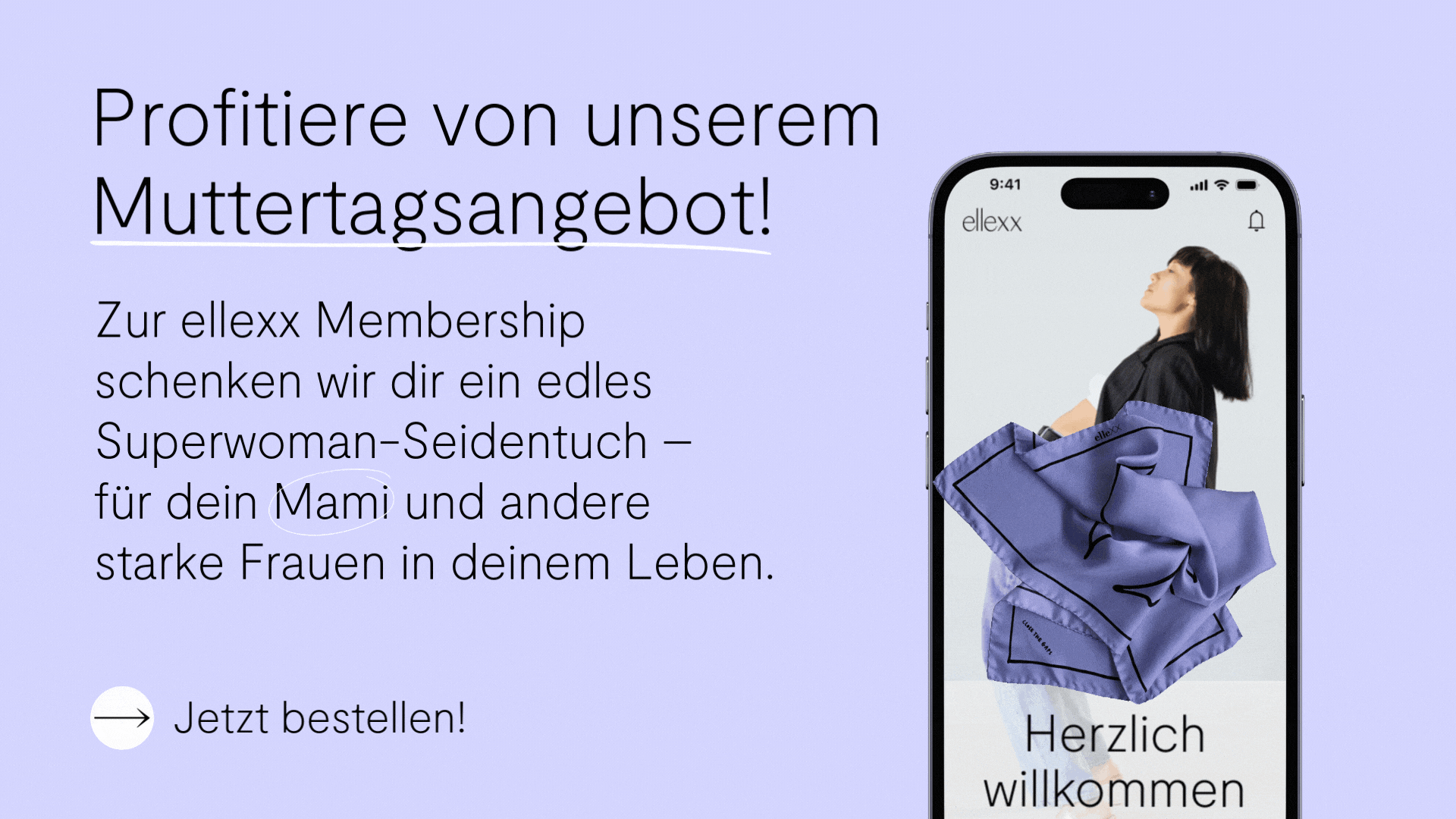
.png-.jpg)








