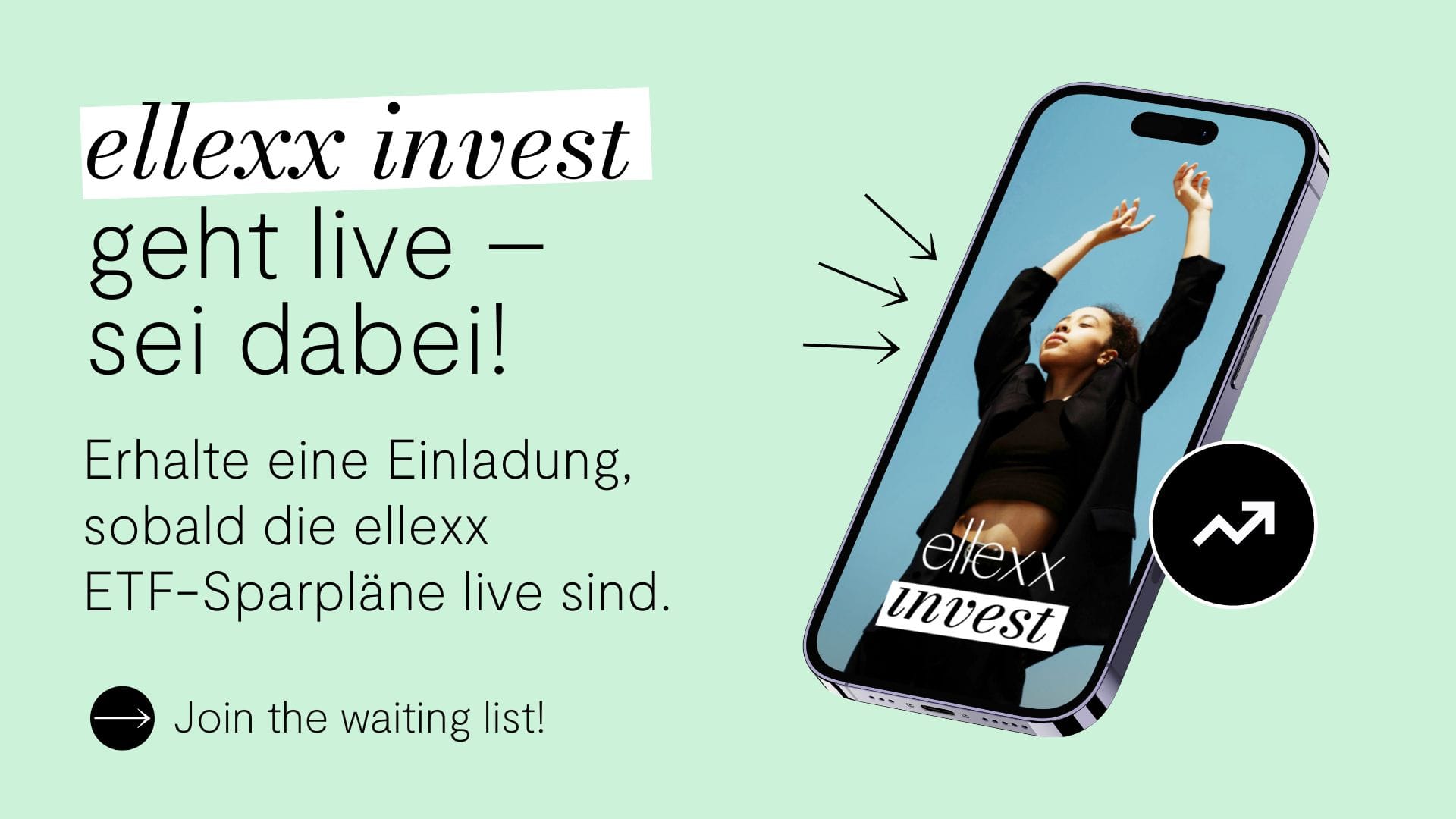Die Schweiz gehört zu den reichsten Ländern der Welt – so viel wissen wir alle. Im Schnitt besitzt ein:e Schweizer Bürger:in 560’000 Franken pro Kopf. Jede:r sechste Erwachsene hier im Land ist ein:e Millionär:in – das sind 16,67 Prozent der Gesamtbevölkerung, rund 400’000 Menschen. Damit stehen wir im globalen Vermögensranking an der Spitze: In Deutschland «knacken» zum Beispiel nur 4 Prozent der Bevölkerung diese Grenze.
Dass dieser Reichtum nicht gleichmässig verteilt ist, dürfte ebenfalls niemanden überraschen. Die meisten Menschen verfügen über nicht annähernd so viel, während eine Minderheit riesige Vermögen anhäuft. In der Regel sind dies Angehörige der Mehrheitsbevölkerung mit privilegiertem Zugang zum Kapitalmarkt – also tendenziell ältere, weisse, europäische Männer.
Studien schätzen, dass Frauen in Westeuropa nur rund einen Drittel des privaten Vermögens halten – ein Gap, der nicht über Nacht entstanden ist, sondern sich in vielen kleinen Schritten aufgebaut und verfestigt hat. Dazu gehören zum Beispiel Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern (Gender Pay Gap) oder unbezahlte Care-Arbeit.
Auch unterschiedlich grosse Kapitalanlagen in Kombination mit anderem Risikoverhalten (Frauen investieren in der Regel konservativer und machen weniger kurzfristige Rendite), rechtliche und institutionelle Barrieren (in manchen Ländern haben Frauen im Vergleich zu Männern etwa noch immer erschwerten Zugang zu Krediten) sowie die Benachteiligung von Frauen in Bezug auf Erbschaften zählen dazu.
Vermaledeites vererbtes Vermögen
Womit wir endlich beim Thema wären: den vermaledeiten vererbten Vermögen, oder in meinem Fall dem eklatanten Mangel daran – dazu komme ich gleich. Zunächst möchte ich euch die wichtigsten Kennzahlen in Sachen Erbschaft in der Eidgenossenschaft um die Ohren hauen.
Erbschaften sind in der Schweiz die Hauptursache von Reichtum, ganz generell gesprochen. Studien belegen: Jeder zweite Vermögensfranken in der Schweiz ist geerbt. Das jährlich per Erbschaft weitergegebene Vermögen wird auf 100 Milliarden Franken geschätzt und entspricht etwa 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP.
Diese Erbmasse ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark gewachsen: Sie ist heute etwa fünfmal so hoch wie noch vor 30 Jahren. Und auch hier kann von gerechter Verteilung keine Rede sein: 10 Prozent der Erb:innen erhalten rund 75 Prozent des gesamten Schweizerischen Erbvolumens, und ein Drittel der Bevölkerung erbt gar nichts.
Unzulänglichkeiten ausgleichen
Zum letzten Drittel gehöre ich. Mein Vater war ein ziemlicher Verlierer, und zwar in fast jeder Hinsicht, auch in Sachen Geld. Er starb, als ich 24 Jahre alt war, und hat mir, abgesehen von einer Viertelmillion Franken Schulden, gar nichts hinterlassen. Ein Erbe, das ich selbstverständlich nicht angetreten habe.
Als mein Grossvater – der Vater meines Vaters – kurz danach ebenfalls verstarb, erbte ich noch einmal: nichts. Es stellte sich heraus, dass mein sauberer Papa seinen Erbanteil vorbezogen und zu Lebzeiten verjubelt hatte.
Meine Mama wiederum lebt noch, ist aber alles andere als auf Rosen gebettet. Sie hat, wie so viele Frauen in der Schweiz, den Löwenanteil ihres Erwachsenenlebens mit unbezahlter Care-Arbeit verbracht – und damit, die Unzulänglichkeiten meines Vaters auszugleichen. Kommt hinzu, dass sie, als ich und mein Bruder klein waren, noch kein eigenes Bankkonto ohne die Unterschrift meines Vaters eröffnen durfte. Wie uncool das war, muss ich nach den Ausführungen über meinen Erzeuger wohl kaum noch erklären.
Geschlechtstypische Vermögenssituation
Wie geschlechtstypisch meine Vermögenssituation ist (oder besser: der eklatante Mangel ebendieser), ist mir vor dem Verfassen dieser Kolumne ehrlich gesagt nie aufgefallen. Aber so ist es. Wie bereits erwähnt, verfügen Frauen in der Schweiz nur über rund zwei Drittel des Vermögens von Männern – und dies hat unter anderem mit Erbschaften zu tun.
Zusammengefasst ist das Thema aus feministischer Perspektive darum interessant, weil oft ungleiche Verhandlungsmacht, Information und Ressourcen (zum Beispiel punkto Rechtsschutz) zwischen Geschlechtern bestehen — insbesondere, wenn Erben unterschiedlich stark mit finanziellen Mitteln juristischen Kenntnissen oder Selbstvertrauen ausgestattet sind.
Dazu existieren keine belegbaren Zahlen, wie so häufig, wenn es um «Frauenthemen» geht. Dennoch bin ich überzeugt, dass meine obige Analyse wahr ist: Wie zum Teufel hätte meine Mutter als junge Frau denn bitteschön monetäre oder juristische Kompetenzen erwerben sollen in einer Welt, in der sie weder abstimmen noch ein Bankkonto eröffnen durfte? Und wie hätte sie Vermögen akkumulieren sollen in einem Alltag, der aus einem saufenden Ehemann und hungrigen Kindern bestand? Ausserdem: Vermögen vermehrt und vererbt sich besser, wo bereits welches besteht, oder anders: Aus nichts kann in der Regel auch nichts werden.
Die Ironie der ganzen Geschichte ist: In einer hypothetischen Welt, in der meine Mutter die gleichen Möglichkeiten wie mein Vater gehabt hätte, wäre das Resultat für mich unter dem Strich deutlich positiver ausfallen. Ich bin mir sicher, dass Gleichberechtigung Zinsen trägt – nicht nur, aber auch beim Thema Erbschaft.
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: