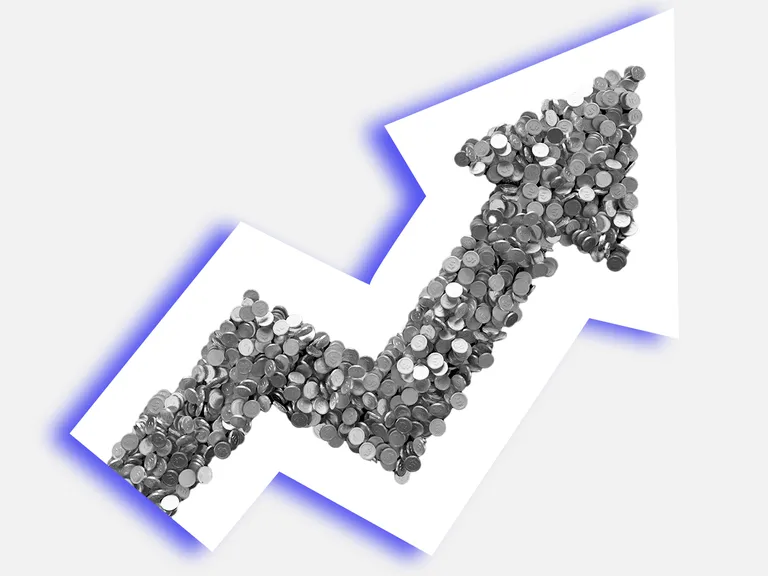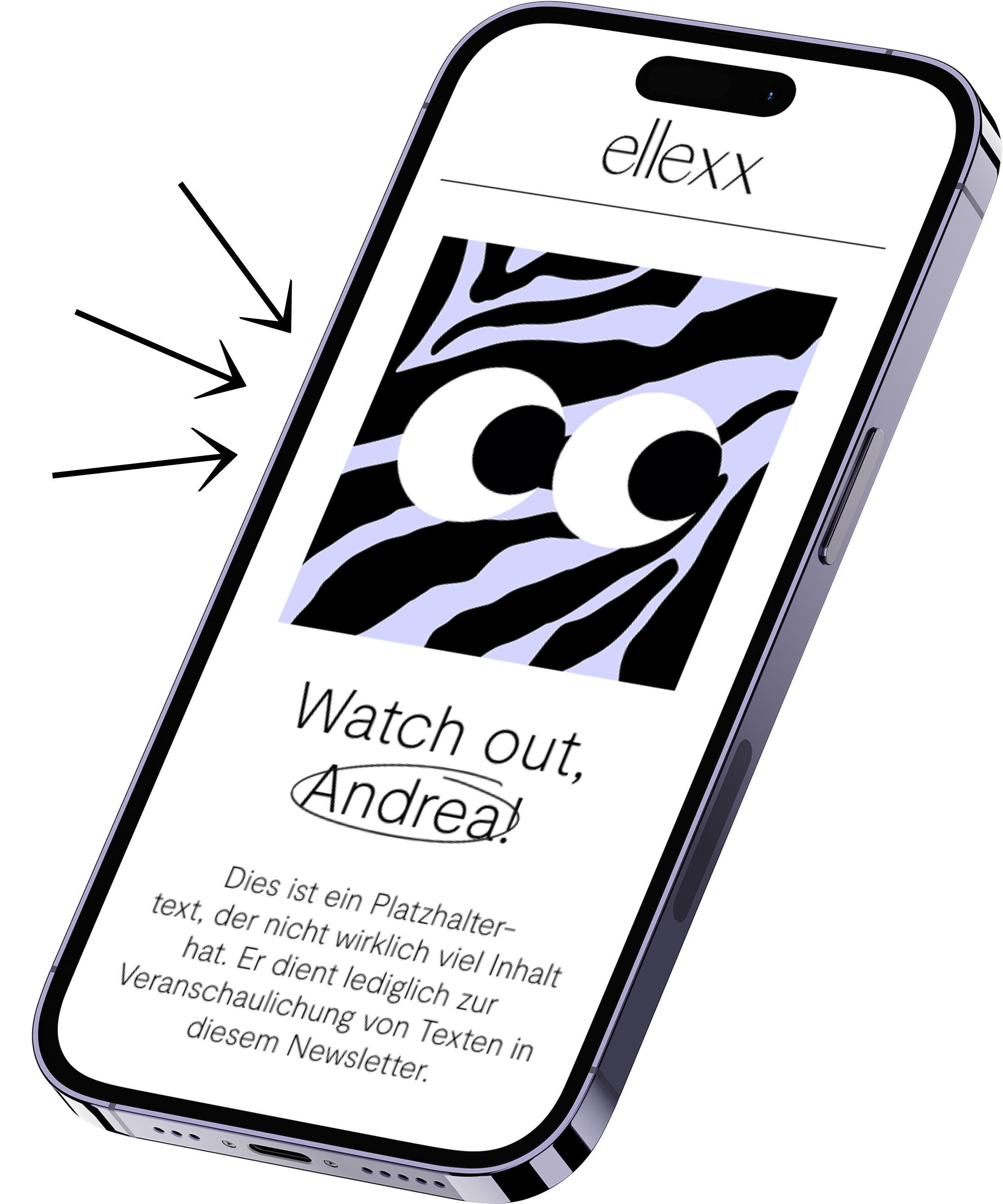Stream the Patriarchy
Seit Anfang 2025 verantworte ich die musikalische Programmation eines Zürcher Clubs. Diese Arbeit führt mir in erschreckender Deutlichkeit (einmal mehr) vor Augen, wie schlecht es um Gleichberechtigung in der Musikindustrie bestellt ist. Vor allem zwei Dinge springen mir ins Auge:
Erstens: Ich habe kaum Kolleginnen im Booking. FLINTA*-Personen sind in der Schweizer Musikbranche – gerade in leitenden Funktionen und im Booking – . Entsprechende quantitative Studien gibt es kaum, persönlich kenne ich nur eine Handvoll Frauen in diesen Positionen. Noch ernüchternder sieht es bei den Besitzverhältnissen aus: Eine AI-Suche listet lediglich drei Clubs in der Schweiz, deren Besitzerinnen offiziell im Impressum genannt sind, auch hier existieren hier keine offiziellen Zahlen.
Rosanna Grüter
Zweitens: Männliche DJs haben ein deutlich grösseres Ego und bewerben sich dementsprechend penetranter um Slots. Seit meinem Stellenantritt im Februar 2025 habe ich unzählige Bewerbungsmails erhalten – darunter genau zwei von Frauen. Das macht meinen Job doppelt schwierig: Während sich viele mittelmässige Männer aufdrängen, muss ich die wirklich talentierten Frauen mühsam aus Proberäumen und Nischen holen, in denen sie seit Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit an ihrem Können feilen.
Die naheliegende Schlussfolgerung, Frauen müssten sich einfach aktiver positionieren und vermarkten, greift allerdings zu kurz. Denn sobald sie es tun, begegnen ihnen ganz andere Hürden als ihren männlichen Kollegen: Sie werden nach ihrem Aussehen bewertet, schlechter bezahlt und seltener gebucht. Dieser Mechanismus macht auch vor Superstars nicht Halt.
Rosanna Grüter
Beyoncé bringt es in ihrem Dokumentarfilm « » auf den Punkt: «Wenn man als Frau in dieser Branche erfolgreich sein will, muss man doppelt so hart arbeiten, um überhaupt ernst genommen zu werden.» Studien – ja, hier gibt es sie endlich – belegen: Der FLINTA*-Anteil in den Line-ups der meisten Schweizer Festivals liegt bei lediglich .
Die Gründe für dieses Ungleichgewicht sind altbekannt – und ebenso ernüchternd: weniger Förderung in der Kindheit, geringerer Zugang zu Netzwerken, gläserne Decken, Lohnungleichheit, häufigere Diskriminierung und Belästigung sowie strukturelle Benachteiligungen bei Mutterschaft, um nur einige zu nennen.
Seit einigen Jahren verstärken die Algorithmen von Streamingplattformen wie Spotify diese Schieflage zusätzlich. Sie empfehlen vor allem Künstler, die ohnehin schon viele Streams haben – und das sind überwiegend Männer. Studien zeigen: Der Anteil von FLINTA*-Acts auf grossen Playlists liegt meist . Je öfter ein Song gestreamt wird, desto häufiger taucht er wieder in Playlists auf – für FLINTA*-Artists ein kaum zu durchbrechender Kreislauf.
Hinzu kommt, dass Spotify seine Gewinne in Strukturen investiert, die feministische Bemühungen um ökonomische Teilhabe untergraben – nicht nur in der Musik. Dazu gehören Rüstungsunternehmen wie Helsing, das KI-gestützte Überwachungs- und Waffentechnik entwickelt, ebenso wie politische Veranstaltungen für Akteure wie Donald Trump. Wenn Streaming-Gelder in solche Projekte fliessen, verstärkt das bestehende Machtverhältnisse und benachteiligt genau jene, die ohnehin weniger Chancen haben.
Rosanna Grüter
Für FLINTA-Künstlerinnen verschärft sich die Lage damit doppelt: Sie kämpfen um faire Bezahlung, Sichtbarkeit und Teilhabe, während Gewinne weiterhin in männlich dominierte Netzwerke fliessen. Damit bleibt Musik in ihrem gesellschaftlichen Potenzial blockiert – anstatt Motor für Gleichstellung und Diversität zu sein. Kultur kann nur wirken, wenn Frauen und FLINTA*-Personen frei, sicher und fair arbeiten können.
Billie Eilish formuliert es treffend: «Talent kennt kein Geschlecht – aber viele Türen in der Branche sind noch immer für Männer reserviert.» Studien zeigen, dass FLINTA*-Acts bei internationalen Preisen ausmachen.
Die Debatte über Sexismus im Musikmarkt ist wichtiger denn je, denn: Alle, die Musik hören oder streamen, sind Teil eines Systems, das unseren Konsum formt und damit Strukturen und ultimativ die Musik an sich beeinflusst.
Oder anders: Jeder Person, die sich wirklich für Musik interessiert, sollte bewusst sein, wie viel gute Musik ihr entgeht, wenn es der Mehrheit der Menschen verunmöglicht wird, welche zu machen.